
Gedankensplitter — fragmentarische Aufzeichnungen. Es sind Standpunkte, Kommentare, Überlegungen und Erlebnisse, die hier zutage treten. Aus Gründen der besseren Lesbarkeit, ist diese Seite auch auch in einer Reader-Version verfügbar. Den entsprechenden Button sollten Sie in Ihrer Browserleiste finden.
01.12.23 Den Standpunkt wechseln

Gerade für Führungskräfte und Entscheidungsträger:innen ist es von besonderer Bedeutung, den Standpunkt der Betrachtung bisweilen zu ändern. Standpunkte gibt es dabei viele. Welcher ist der richtige?
Der Standpunkt der Philosophie: jenseits der Anziehungskraft des Praktischen, der Alltagsrealität, des Nebulösen – eine Welt im Blick, die sich hinter dem Getöse des empirisch Wirklichen verbirgt.
Atemberaubend. Einzigartig. Lehrreich.
16.10.2023: Das Problem der Nicht-Identität von Wahrnehmungswelt und Realwelt
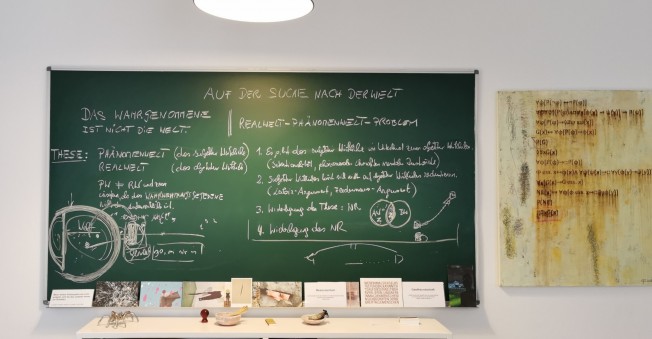
Was uns in der Wahrnehmung vorliegt, – das Wahrnehmungsgegebene –, halten wir gemeinhin für die Welt. Doch mit welcher Art von Welt haben wir es zu tun? Ist es in der Tat eine Welt, die vom Subjekt und seinen spezifischen Bedingtheiten unabhängig existiert? Oder ist es eine Welt, die vom Subjekt selbst hervorgebracht wird? Gibt es überhaupt eine Welt jenseits von Bewusstsein und Wahrnehmung und wenn ja, lässt sie sich erkennen? Die in diesen Fragen artikulierte Suche nach der Welt ist eines der spannendsten Denkabenteuer der Philosophie, nicht nur für Philosophinnen und Philosophen.
06.07.2023: Das Problem mit der Erfahrung

Ist es nicht die Erfahrung und unser Wissen über Tatsachen, worauf wir so große Stücke halten? Geht es nach dem schottischen Philosophen David Hume, sollten wir äußerst skeptisch sein. In den “Untersuchungen über den menschlichen Verstand” schreibt er:
“Auf die Frage: was ist das Wesen all unserer Denkakte in betreff von Tatsachen, scheint die richtige Antwort zu sein, daß sie sich auf die Beziehung von Ursache und Wirkung gründen. Auf die weitere Frage: was ist die Grundlage all unserer Denkakte und Schlüsse in betreff dieser Beziehung, kann man mit einem Wort erwidern: ERFAHRUNG.” Was aber ist die Grundlage aller Schlüsse, die wir aus der Erfahrung ziehen? “Gewohnheit”! Doch die Behauptung z. B., dass “die Sonne morgen nicht aufgehen wird, ist ein nicht minder verständlicher Satz und nicht widerspruchsvoller, als die Behauptung, daß sie aufgehen wird”. “So groß ist der Einfluss der Gewohnheit, daß da, wo sie am stärksten ist, sie nicht nur unsere natürliche Unwissenheit verdeckt, sondern auch sich selbst verbirgt, und nur deshalb nicht da zu sein scheint, weil sie in höchstem Grade vorhanden ist.” (Hume, David: Untersuchungen über den menschlichen Verstand, Meiner, Hamburg, 2005, S. 35-51)
29.06.2023: Warum man sich mit Philosophie beschäftigen soll?

“Man soll sich mit der Philosophie nicht so sehr wegen irgendwelcher bestimmter Antworten auf ihre Fragen beschäftigen – denn in der Regel kann man diese bestimmten Antworten nicht als wahr erkennen. Man soll sich um der Fragen selber willen mit ihr beschäftigen, weil sie unsere Vorstellung von dem, was möglich ist, verbessern, unsere intellektuelle Phantasie bereichern und die dogmatische Sicherheit vermindern, die den Geist gegen alle Spekulation verschließt. Vor allem aber werden wir durch die Größe der Welt, die die Philosophie betrachtet, selber zu etwas Größerem gemacht und zu jener Einheit mit der Welt fähig, die das größte Gut ist, das man ihr finden kann.” (Russel, Betrand: Probleme der Philosophie, Suhrkamp, Frankfurt am Main, 1967, S. 142)
(Bild: Amel Uzunovic)
26.06.2023: Philosophie meets Industrie

Ein sehr inspirierender Montag mit Chris Müller von CMb.industries in der Grande Garage der (ehemaligen) Tabakfabrik Linz und mit Dr. Ernst Balla, Direktor Human Resources für die Voestalpine!
Sollte uns in der Tat an einer Transformation der Welt liegen, so muss uns an einer Transformation von uns selbst liegen. Und diese Transformation ist notwendig eine Transformation des Geistes. Denn: “So, wie wir denken, leben wir. Darum ist das Sammeln philosophischer Ideen mehr als ein Studium für Spezialisten. Es formt unseren Typ der Zivilisation.” (Alfred North Whitehead)
Vielen Dank für den erbaulichen Brückenschlag zwischen Industrie und Philosophie.
12.06.2023: Sommerakademie der School of Philosophy

Ein herrliche, inspirierende und überaus freundschaftliche philosophische Woche liegt hinter mir. Erneut eine intellektuelle Welterfahrung außergewöhnlicher Art. Was wir erlebt haben, neben all den Genüssen der Toskana? Die Welt, von der wir selbst ein Teil sind, philosophisch gedeutet aus zwei Perspektiven, Standpunkte, die man nicht zugleich einzunehmen vermag. Und dennoch: Zwei Arten und Weisen mit den Phänomenen des Wirklichen umzugehen, wie sie fantastischer kaum sein könnten – Gottfried Wilhelm Leibnizens ›Monadologie‹ und Arthur Schopenhauers ›Die Welt als Wille und Vorstellung‹.
In dem einen Fall, mithin im Fall Leibnizens, ist die Welt, von der wir selbst ein Teil sind, nichts als ein von Gott geschöpftes Universum unendlich vieler, beseelter, in sich selbst geschlossener Einzelwesen, den Monaden, den fensterlosen, auf ewig voneinander getrennten, immateriellen metaphysischen Punkten. Zugleich aber, dieses ganze Universum spiegelnd, sind sie mit allem überhaupt zutiefst verwoben: prästabiliert. Denn die Blaupause der Schöpfung, die Hintergrundfolie dieser unserer Welt, ist ein von Gott vollständig vorausgedachtes, logisch widerspruchsfreies, begriffliches Gebilde, in dem alles mit allem aufs Beste, mithin harmonisch zusammenklingt. Sie, die Schöpfung, ist, mit anderen Worten gesagt, die beste aller logisch möglichen. Dass es in ihr nichtsdestoweniger Übel gibt – ein Quantum, das dem einen oder anderen sogar die Zornesröte ins Gesicht steigen lässt –, liegt daran, dass Gott, will er überhaupt schöpfen, einzig und allein zu schöpfen imstande ist, was moralisch unvollkommen ist, mithin einen Mangel an Gutem enthält. Schlicht und ergreifend deshalb, weil alles Vollkommene mit Gott identisch ist und das, was miteinander identisch ist, kann nicht voneinander verschieden sein.
In dem anderen Fall, mithin im Fall Schopenhauers, ist die Welt, von der wir selbst ein Teil sind, zunächst und eigentlich nichts als Vorstellung. Dasjenige, das wir gemeinhin als das uns gegenüberliegende, empirische, kausal geordnete und sich in Raum und Zeit aufspannende Wirkliche wahrnehmen. Die Blaupause dieses Wirklichen liegt nicht wie noch bei Leibniz in Gott – den es bei Schopenhauer gar nicht mehr gibt –, sondern allein im Subjekt, mithin im Geist, im Bewusstsein. Subjekt und Objekt sind daher untrennbar miteinander verwoben. Vorstellendes und Vorgestelltes bedingen einander, denn Bewusstsein ist stets Bewusstsein von etwas. Ohne Subjekt, keine Welt und ohne Welt, kein Subjekt. Doch auch bei Schopenhauer droht nicht der Absturz in die Dunkelheit der Illusion, auch wenn der Preis hoch ist, denn das, worin alle Vorstellung ihren Ursprung hat, ist Wille. Weltwille; das An-sich, das dem Für-uns zugrunde liegt, dasjenige, das dem Schleier der Maya transzendent ist, aber zugleich sein Anfang. Zwei Reiche, die erkenntnislogisch auf ewig voneinander getrennt sind, wie noch bei Kant? Nicht bei Schopenhauer, denn im Unterschied zu Kant tritt eine Figur auf, die Bürgerin beider Reiche zu sein vermag: der Leib. Im Leib nämlich objektiviert sich der Wille. Der Realgrund der Tatsache, dass wir zutiefst bedürftige, mithin Mängelwesen sind und einmal dies wollend, einmal das von der einen misslichen Lage in die nächste gewuchtet werden. Spielbälle dieses Willens, dieses blinden Triebs sind wir, dessen individuiertes Wollen in dauerndem Konflikt zueinandersteht. Aneinandergekettet wie die Sklaven auf den Galeeren der Handelsgesellschaften des 19. Jahrhunderts leiden wir am gemeinsamen Dasein. Für immer? Für immer! Mit Ausnahme derer, die mehr zu sein vermögen als bloße Fabriksware der Natur. Diejenigen, die dazu in der Lage sind, die platonischen Ideen zu schauen, die unvermittelte Vorstellung des Willens, und die sich in dieser Schau selbst loswerden, die mithin willenlose Subjekte sind – einen Wimpernschlag lang. Das Mittel der Wahl: die Kunst. Das Werk des Genius. Es wiederholt die platonischen Ideen und stellt sie uns vor Augen. Doch letztlich nur ein Quietiv, nichts von Dauer. Der Spiegel der Welt, der wir in jenen raren Momenten sind, muss zerbrechen. Denn die endgültige Überwindung unseres Sklavendienstes am Willen, des Willens zum Leben – die Überwindung allen Wollens, der Bedürfnisse und des Leidens –, liegt nicht in der Bejahung desselben, die ihm nur scheinbar den Giftzahn zieht, den Stachel aus dem Fleisch des Vorstellenden reißt, sondern einzig und allein in seiner Verneinung. Den Willen zum Leben verneinen, das aber heißt, den Unterschied zwischen mir und allem anderen aufzuheben: Auslöschung des vorstellenden, für sich selbst bestehenden Subjekts. Um es in freier Assoziation mit Gottfried Wilhelm Leibniz, die Sommerakademie 2023 beendend und an den Anfang unserer Reise zurückkehrend zu sagen: Das Ende aller Schöpfung. Der Untergang der Monade. Das Verschwinden eines ganzen Universums.
© Bild: Chris Müller
23.03.2021: Lehrgang ›Grundlagen der Philosophie‹

Trotz einigermaßen widriger Umstände konnten wir unseren Lehrgang über die Grundlagen der Philosophie an der Academia Philosophia erfolgreich abschließen. Über einen Zeitraum von 2×5 Tagen haben wir uns entlang der Geschichte der Philosophie mit den Kerndisziplinen des philosophischen Denkens auseinandergesetzt: Logik, Erkenntnistheorie, Metaphysik und Ethik.
Ich bedanke mich bei unseren TeilnehmerInnen für das großartige Engagement und die schöne Zeit im Kreis gleichgesinnter.
12.03.2021: "Willkommen Österreich"

Die Philosophen der Academia Philosophia als Requisiten bei “Willkommen Österreich”. Genau der richtige Platz für die Hohepriester des Nutzlosen.
06.02.2021: Genug Pandemie? Lesen Sie doch Spinoza!

Was uns nämlich Baruch de Spinoza in seinem Hauptwerk ›Ethik in geometrischer Ordnung dargestellt‹ vorlegt, das ist eine Theorie der Freiheit des Menschen. Was sie offenzulegen sucht ist ein Weg, der zu einem gelingenden Leben führt. Ein Weg, der auf zwei Grundüberzeugung aufruht: Erstens, dass sich die Welt insgesamt durch unseren Verstand begreifen lässt, d. h., dass sie intelligibel ist, dass es keine verborgenen, unbegreiflichen Qualitäten gibt, wie sie in der jahrhundertealten Tradition der mystisch-religiösen Welterklärung fundamental sind; und zweitens, dass das gelingende menschliche Leben ein solches ist, das sich dieser Intelligibilität verpflichtet. Was damit einhergehend gesollt ist, ist das Trachten nach einer adäquaten Erkenntnis der Welt, nach der Herrschaft über die Affekte – die aus dem Streben nach Selbsterhaltung resultieren und im Zusammenspiel mit der zeitlichen Verfasstheit des Menschen dazu führen, dass ihm das Wirkliche in perspektivischer Verzerrung erscheint –, sodass zuletzt, sub specie aeternitatis, die Welt an sich zum Vorschein kommt und der Mensch einen Standpunkt einzunehmen vermag, der ihn aus der Knechtschaft äußerer Einflussfaktoren befreit und ihm zum höchsten Glück verhilft, nämlich zu Selbstbestimmung und Freiheit.
Ich empfehle die bei Felix Meiner erschienene, sich auf Carl Gebhardts kritische Ausgabe stützende Edition der spinozanischen Ethik: ›De Spinoza, Baruch: Ethik in geometrischer Ordnung dargestellt, Hamburg, 2010‹.
05.09.2020: Sommerakademie, Toskana, Italien

Eine herrliche Sommerakademie liegt hinter mir. Auch im heurigen Jahr zeigten sich uns zwei philosophische Schwergewichte: René Descartes und Karl Marx. Revolutionäre Denker waren sie beide, wenngleich von ganz unterschiedlicher Färbung.
René Descartes sucht im Ausgang des Mittelalters ein notwendiges, unbezweifelbares Fundament der Wahrheit, das er in der metaphysischen Grundlegung des ontologischen Verhältnisses von Ich, Gott und Welt findet und worauf aufruhend zur Erkenntnis der ganzen Wirklichkeit übergegangen werden kann. Das von den Griechen in Angriff genommene Projekt der Erkenntnis, das in der Philosophie des Mittelalters, ob der engen Verflechtung mit der christlichen Glaubenslehre, stagnieren musste, konnte nun auf rational gesichertem Weg – am Übergang von theologischer Metaphysik zur theoretischen Physik – weitergeführt werden. Praktische Philosophie, wie Descartes zu sagen pflegte: methodengeleitete Verständlichmachung der Welt zur Behebung der menschlichen Leiden und zur Ausbeutung der Natur.
Karl Marx wiederum entwirft, eingebettet in eine dramatische, passagenweise durchaus tragische Lebensgeschichte, durchzogen von persönlichen Krisen und den umstürzlerischen politischen Vorgängen im Europa seiner Zeit, das theoretisch-philosophische Fundament des wissenschaftlichen Sozialismus. Sein historischer Materialismus, der Hegel vom Kopf auf die Beine stellt, indem nicht der Geist das Seiende bestimmt, sondern umgekehrt die materiellen Produktionsverhältnisse unseren Geist, zeigt die Geschichte der Menschheit als eine notwendige Geschichte der Klassenkämpfe, als eine Geschichte der Revolutionen, deren letzte im Sturz des Kapitalismus und im Übergang zum Sozialismus besteht. In seiner radikalen Kapitalismuskritik wird offengelegt, warum: Die funktionale Grundstruktur des kapitalistischen Systems führt zu einem disjunkten Zerfall der Gesellschaft, und zwar in die Menge der Kapitalisten auf der einen Seite und die Menge der Arbeiter auf der anderen. Während im Reich der Kapitalisten Eigentum und Kapital kumulieren, kumulieren im Reich der Arbeiter Armut und Elend; und zwar solange, bis sich die Arbeiter, die Proletarier aller Länder vereinigen und der letzte große Umsturz beginnt. Ein Umsturz, der zu einer Welt freier Menschen führt, die den Gott ›Geld‹ überwunden haben und eine Gesellschaft vorliegt, worin die Beziehung der Menschen zueinander erstmals als eine unmittelbare, unverstellte realisiert ist.
Literatur:
Descartes, René: Discour de la Méthode, Meiner, Hamburg, 2011.
Descartes, René: Meditationes de prima philosophia, Meiner, Hamburg, 2008.
Wass, Bernd: Der Neubeginn der Philosophie, Über René Descartes’ Discour de la Méthode und die Meditationes de prima philosophia, Tredition, Hamburg, 2020.
Marx, Karl: Kritik des Kapitalismus, Suhrkamp, Berlin, 2018.
20.06.2020: Grundlagen der Philosophie — Buchneuerscheinung!
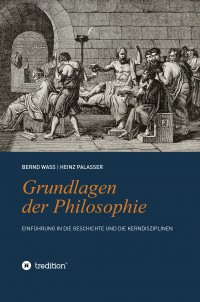
Bernd Wass und Heinz Palasser legen eine neue Abhandlung vor! Sie ist dem Wunsch entsprungen, ein Einführungsbuch zur Hand zu haben, das den Anforderungen unserer Lehrtätigkeit an der Academia Philosophia entspricht: einem Laien die Grundlagen der Philosophie näher zu bringen – außerhalb der Mauern der Universitäten, aber nichtsdestoweniger auf angemessenem theoretischen Niveau. Man hat es also im Eigentlichen mit einem Lehrmittel zu tun. Während der vielen Jahre, die wir es nun schon im Gebrauch haben, haben wir es nicht zuletzt in der Debatte mit den Studierenden stets weiterentwickelt, sodass es heute, wie wir glauben, einem größeren Kreis von Interessierten zur Verfügung gestellt werden kann. Der Text soll dazu beitragen, sich im scheinbar undurchdringlichen Labyrinth philosophischer Auffassungen, Positionen und Theorien zu orientieren; ein tiefergehendes Verständnis der genuinen Problem- und Fragestellungen auszubilden, mit denen wir es in der Philosophie zu tun haben; die arttypische Weise des philosophischen Denkens zu erfassen und den Abstraktionsgrad sowie die Präzision des eigenen Denkens zu erhöhen.
10.05.2020: René Descartes — Buchneuerscheinung!
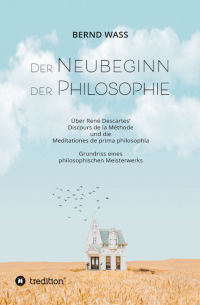
Wie kaum ein anderer Denker steht René Descartes für den Neubeginn der Philosophie. Ein Neubeginn, der vor allem entlang seiner beiden Hauptwerke, ›Discours de la Méthode‹ und ›Meditationes de prima philosophia‹, auskristallisiert. Es ist die Zurückweisung der ungeheuren epistemischen Sicherheit des Mittelalters samt der Philosophie seiner Autoritäten, die Abkehr von der Naturphilosophie Aristoteles’, die methodologisch fundierte und begrifflich präzise Ausgestaltung der tradierten Beziehung von Ich, Welt und Gott, aber auch die literarische Selbstinszenierung, die Descartes berühmt werden lässt.
Vor dem Hintergrund der Philosophie des Mittelalters und den philosophiehistorischen Implikationen des Cartesianismus habe ich versucht, die außergewöhnliche Bedeutung Descartes’ für das moderne Denken, die Originalität seiner Philosophie und den Grundriss seiner beiden Hauptwerke herauszuarbeiten.
28.01.2020: Menschenwürde und Menschenrechte

„Alle Menschen sind frei geboren und gleich an Würde und Rechten. Alle haben Vernunft und Gewissen und sollen untereinander im Sinne der Brüderlichkeit handeln.“ In diesem ersten Artikel der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte von 1948 finden sich die beiden zentralen Begriffe, die man philosophisch zu durchdringen hat, so einem daran gelegen ist, dass Selbstverständliche seiner Selbstverständlichkeit zu berauben und sich seiner grundlegenden Fragen und Probleme zuzuwenden: ›Würde‹ und ›Rechte‹. Im Kolloquium zur Menschenwürde der Academia Philosophia haben wir uns mit einem brandaktuellen Thema beschäftigt, nicht zuletzt ob der politischen Entwicklungen im Inn- und Ausland.
Eine Rückschau zum Download:
 Menschenwürde und Menschenrechte - 365 kB
Menschenwürde und Menschenrechte - 365 kB08.12.2019: Philosophie der Revolution

Die Geschichte der Menschheit ist, allem Anschein nach, eine Geschichte der Revolutionen. Doch was genau sind Revolutionen? Worauf fußen sie? Was bezwecken sie? Wer löst sie aus? Und wie werden sie durchgesetzt? Das sind Fragen, die eine philosophische Theorie der Revolution jedenfalls zu beantworten hat. Sie zielen darauf ab, das Wesen des Revolutionären theoretisch befriedigend zu erfassen. Im Kolloquium zur Philosophie der Revolution, dem letzten Kolloquium der Academia Philosophia des Jahres 2019, haben wir uns daher entlang dieser revolutionstheoretischen Fragestellungen, und aus der Perspektive der Philosophie, mit der Geschichte der Revolution beschäftigt.
Eine Rückschau zum Download:
 Philosophie der Revolution - 379 kB
Philosophie der Revolution - 379 kB02.10.2019: Philosophie des Bewusstseins

Mit dem Kolloquium der Academia Philosophia zur Philosophie des Bewusstseins haben wir einem Phänomen nachgespürt, das uns vertrauter nicht sein könnte, das uns aber nichtsdestoweniger vor gewaltige Schwierigkeiten stellt, sobald wir versuchen, es von einem philosophischen also theoretischen Standpunkt aus einzusehen: dem Phänomen des Bewusstseins. Bewusstsein ist auf der einen Seite die Helligkeit der Wirklichkeit, wie es Franz von Kutschera ausdrückt, die fundamentalste Bedingung dafür, dass es für uns etwas gibt – und selbst ebenso wie die Außenwelt. Auf der anderen Seite ist es ein wesentliches Merkmal von Subjekten; die unhintergehbare Demarkation zwischen etwas und jemand. Mit dem Auftreten von Bewusstsein, also mit dem Auftreten des Geistigen, des Mentalen, erhält die Realität eine völlig neue Dimension, die in der Physik allem Anschein nach keine Parallele hat. Bewusstsein ist nicht definierbar und auch nur schwer zu erläutern – wir können es, um erneut Kutschera zu zitieren, trivialerweise niemandem begreiflich machen, der es nicht hat. Das liegt nicht zuletzt daran, dass es sich um ein transempirisches, die Wahrnehmung transzendierendes, der sinnlichen Beobachtung radikal unzugängliches, Phänomen handelt; weshalb es in der Philosophie von jeher im Rahmen der Metaphysik verhandelt wird und lange Zeit kein Gegenstand der Naturwissenschaft war. Als ein Gegenstand der Metaphysik, genauer der speziellen Metaphysik, insbesondere der philosophischen Psychologie, oder moderner, der Philosophie des Geistes, lässt es sich in drei Problemfelder zerlegen: in das Problemfeld des phänomenalen Bewusstseins, als des phänomenologischen Grundproblems der Philosophie des Geistes; in das Problemfeld des Leib-Seele-Problems, als des ontologischen Grundproblems der Philosophie des Geistes; und in das Problemfeld der Intentionalität, sowie der damit verbundenen Repräsentation von Welt, als des erkenntnistheoretischen Grundproblems der Philosophie des Geistes. Mit dem Aufstieg der Philosophie des Geistes zu einer der prosperierendsten philosophischen Disziplinen, nicht zuletzt befeuert durch die gewaltigen Bemühungen der Hirnforschung, dem Phänomen ›Bewusstsein‹ vermittelst naturwissenschaftlicher Methodik näher zu kommen, hat sich auch die Problempriorität verschoben: War es früher das Verhältnis von Leib und Seele, das als das große Rätsel galt, so ist es heute das phänomenale Bewusstsein – die Tatsache, dass bewusste Wesen über eine subjektive Erlebnisperspektive verfügen. Was genau man darunter zu verstehen hat, das hat uns am besten Thomas Nagel vor Augen geführt. In seinem berühmten Aufsatz ›Wie ist es, eine Fledermaus zu sein?‹ sucht er Wesen, die über eine solche subjektive Erlebnisperspektive verfügen, als Wesen zu begreifen, für die es stets irgendwie ist dieses oder jenes Wesen zu sein. Jede einigermaßen vollständige Theorie des Geistes, insbesondere jede empirische Theorie desselben, steht nun vor dem fundamentalen Problem, zu erklären, worum es sich bei dieser Erlebnisperspektive handelt; was genau es heißt, dass es irgendwie ist, dieses oder jenes Wesen zu sein. Doch dies, so sind zumindest einige Philosophinnen und Philosophen geneigt zu behaupten, ist prinzipiell unmöglich, denn es bedeutet nichts Geringeres als das radikal Subjektive vollständig zu objektivieren.
Die philosophischen Theorien des Bewusstseins, die sich anschicken das Problem des phänomenalen Bewusstseins zu lösen, lassen sich jedenfalls in funktionalistische und repräsentationalistische Theorien zergliedern. Während die einen versuchen phänomenales Bewusstsein auf bestimmte funktionale Zusammenhänge – etwa im Gehirn – zurückzuführen, so versuchen es die anderen auf die Vorstellung der mentalen Repräsentation zu gründen. Phänomenales Bewusstsein besteht in der mentalen Repräsentation eines Organismus von Welt. In dem die Welt – es mag die materielle Außenwelt oder die geistige Innenwelt sein – vom Organismus auf einer niedereren Stufe mental repräsentiert wird, kommt es zur Konstitution des höherstufigen phänomenalen Bewusstseins. Die Intention dieser Vorstellung findet sich am klarsten bei Fred Dretske formuliert: „Bei bewussten mentalen Zuständen – insbesondere Erfahrungen – handelt es sich nicht um Zustände von denen wir Bewusstsein haben, sondern um Zustände, durch die wir Bewusstsein haben.“ Die Auskleidung dieses Gedankengangs lässt sich nun entweder auf dem Weg des einfachen Repräsentationalismus – den sogenannten horizontalen Theorien – bewerkstelligen, oder auf dem Weg des Metarepräsentationalismus – den sogenannten vertikalen Theorien. In horizontalen Theorien wird davon ausgegangen, dass die mentale Repräsentation der Außen- wie Innenwelt des Organismus hinreicht, um phänomenales Bewusstsein zu konstituieren; in vertikalen Theorien wiederum wird behauptet, dass es eines zusätzlichen Akts bedarf, einer Metaebene, nämlich entweder der Introspektion – der auf die eigenen mentalen Zustände gerichteten inneren Wahrnehmung – oder der Begleitung bestimmter mentaler Zustände durch nicht-inferentielle, nicht-dispositionale, assertorische Gedanken. Wir sind uns demnach bestimmter mentaler Zustände bewusst, indem wir Gedanken in Bezug auf sie haben, wie es David Rosenthal sinngemäß formuliert.
Nun muss man aber, der Redlichkeit halber, sagen, dass sowohl die einfachen wie auch die metarepräsentationalistischen Ansätze gravierende philosophische Probleme aufweisen, die umso größer werden, je materialistischer man sie auszudeuten sucht. Den wenn man erst einmal bei der Rede vom inneren Scanner angekommen ist, vom Teil eines Nervensystems, das einen anderen Teil scannt, nämlich jenen Teil, der seinerseits die Umwelt und die inneren Zustände des Wesens scannt, das dieses Nervensystem hat, so scheint man das zu erklärende Zielphänomen, nämlich das phänomenale Bewusstsein, immer weiter aus den Augen zu verlieren, bis es schließlich ganz verloren geht. Ist doch die fundamentale Frage die: Wie um alles in der Welt lässt sich die moderne Sicht des uns bekannten Universums, als eines materiellen, räumlich-zeitlichen, kausal geschlossenen und empirisch zugänglichen Gebildes, mit der Tatsache in Einklang bringen, dass es Entitäten – Daseinsformen – gibt, die über eine nicht-materielle, subjektive Erlebnisperspektive verfügen?
Am Ende also wieder nichts – keine Lösung in Sicht. Doch man soll sich, um es mit Bertrand Russell zu sagen, mit der Philosophie ohnehin nicht um der Lösungen wegen beschäftigen, weil sie wirklich selten, wenn überhaupt zu haben sind, sondern der Möglichkeiten wegen, die es zu bedenken gilt und die unser geistiges Blickfeld erweitern; sodass wir jetzt zumindest zweifeln können, wenn uns schon bei nächster Gelegenheit ein Theorieangebot ereilt, dass uns die Welt in ein paar wenigen, und oftmals trivialen, Sätzen zu erklären verspricht.
23.09.2019: Sommerakademie, Toskana, Italien

Erstmals haben wir im Jahr 2019 eine zweite Akademie-Woche in der Toskana geführt und waren vom 14.09-21.09. erneut in Castelfranco di Sopra. John Rawls und Günther Anders die Protagonisten: Radikale Gesellschaftskritik am Ende eines Sommers!
14.08.2019: John Rawls – Buchneuerscheinung

Die Frage nach der Gerechtigkeit ist wieder en vogue, nicht nur in der Philosophie. Kein Wunder angesichts der aktuellen Krisen, seien es Staats-, Flüchtlings-, Umwelt- oder Wirtschaftskrisen, der kriegerischen Auseinandersetzungen, die sich über den Globus verteilt zutragen, und der humanitären Katastrophen in ihrem Gefolge. Langsam aber sicher, so scheint es, gerät die, an ein grenzenloses Wachstum glaubende und auf dem Boden unerbittlicher Profitmaximierung aufruhende, postindustrielle Gesellschaft an ihre Grenzen.
John Rawls’ Theorie der sozialen Gerechtigkeit gehört ohne Zweifel zu den wirkmächtigsten philosophischen Texten des 20. Jahrhunderts. In der hier vorliegenden Abhandlung habe ich daher den Versuch unternommen, den Grundriss dieses umfangreichen moral- wie vertragstheoretischen Werks, in dem Prinzipien und Struktur einer gerechten Gesellschaft offengelegt werden, herauszuarbeiten.
17.07.2019: Kunsttheorie im Kunstatelier

Von jeher sucht der Mensch die Welt, und also auch sich selbst, zu verstehen. Und obschon das Ziel stets dasselbe ist, nämlich Selbstverständigung, sind die Wege, um es zu erreichen, doch von großer Verschiedenheit: Wissenschaft, Religion und gemeines Alltagsdenken auf der eine Seite; KUNST auf der anderen. Schon immer hat die Kunst im Leben des Menschen eine zentrale Rolle eingenommen und in unserem Kolloquium ›Ästhetik – die Philosophie des Schönen und der Kunst‹ sind wir dieser Rolle auf den Grund gegangen. Im Kunstatelier Mara Schatz haben wir uns zwei Tage lang mit der philosophischen Ästhetik, also der philosophischen Kunsttheorie beschäftigt, um dem Wesen, dem Zweck und dem Vermögen der Kunst nachzuspüren.
Eine Rückschau zum Download:
19.06.2019: Sommerakademie, Toskana, Italien

Soeben kehre ich von meiner einwöchigen Toskanareise zurück; von der Sommerakademie der Academia Philosophia, in deren Zentrum zwei Philosophen standen, die zu den wichtigsten Gesellschaftskritikern des 20. Jahrhunderts gehören: John Rawls und Günther Anders. Der eine, der, wie kaum ein zweiter, den philosophischen Streit über die gerechte Verteilung der menschlichen Grundgüter von einem völlig neuen Standpunkt aus zu entscheiden suchte; und der andere, dessen radikale, und bis heute unübertroffene, Technik- und Fortschrittskritik einem die heilsame Illusion des Fortschritts durch Technik mit dem Philosophenhammer endgültig aus dem Kopf schlägt.
Eine Rückschau zum Download:
 Rückschau, Sommerakademie 2019 - 165 kB
Rückschau, Sommerakademie 2019 - 165 kB09.05.2019: ›Schönheit‹ – Gedankensplitter zu einem Grundbegriff europäischer Kultur

„Schönheit liegt im Auge des Betrachters“. Das ist jene viel zitierte Auffassung, die das Schöne zu einer gänzlich subjektiven Angelegenheit macht. Die Deutungshoheit darüber, was schön öder hässlich ist, was gefällt oder nicht gefällt, was brauchbar oder unbrauchbar ist, wird dem Geschmack des Einzelnen überlassen und über Geschmack lässt sich bekanntlich nicht streiten. Ein Befund, der vor allem jenen Unbehagen bereitet, die sich dem Schönen von Berufswegen anzunähern versuchen und davon überzeugt sind, dass es objektive, allgemein gültige Bestimmungspunkte gibt. Die Frage nach dem Schönen zeigt sich von jeher im Spannungsverhältnis zwischen dem stark subjektiv Schönen, dem schwach subjektiv Schönen und dem objektiv Schönen. In jedem Fall aber ist Schönheit eine Vorstellung, die in fast allen Bereichen unseres Lebens eine zentrale Rolle spielt. Sie stellt einen Wert dar, „der von der Geburt (dem schönen Baby) bis zum Tod (der schönen Leich’) präsent ist“. Schönheit grundiert, wie kaum etwas anderes, die Ziele und Wunschvorstellungen unserer Lebenspraxis: Wir wollen gemeinhin einen schönen Körper, eine schöne Wohnung, einen schönen Urlaub, ein schönes Haus, eine schöne Einrichtung, einen schönen Abend haben, und nicht das Gegenteil davon. Und so stellt sich die Frage, worin genau das Schöne besteht, woran wir festmachen können, in seinem Besitz zu sein.
Ein Kurztext zum Download:
06.05.2019: Kolloquium ›Philosophie des Glücks‹

Es scheint wenig zweifelhaft, dass das Glück – oder wie Aristoteles zu sagen pflegt, die Glückseligkeit – eines der höchsten Güter ist, das der Mensch zu erlangen strebt, wenn nicht überhaupt das höchste. Das liegt wohl daran, dass es das einzige Gut ist, das nicht um irgendeiner anderen Sache wegen angestrebt wird, sondern ausschließlich seiner selbst wegen. Wer endlich glücklich ist, so könnte man sagen, der will sonst nichts mehr. Doch zunächst drängt sich die Frage auf, wovon eigentlich die Rede ist, wenn vom Glück die Rede ist. Blickt man in die Antike, so glaubte man es in der unerschütterlichen Seelenruhe (Ataraxia) zu finden, die sich, epikureisch gedeutet, bei jenen einstellt, die in der Lage sind, die eigene Lust zu vermehren und den eigenen Schmerz zu verringern oder aber stoisch gedeutet, bei jenen, die Lust und Schmerz überwinden, und sich vom Erfolg nicht verführen, vom Misserfolg nicht niederschlagen lassen. Doch bei genauerer Betrachtung muss man den Eindruck gewinnen, dass ein derart eng gefasster Glücksbegriff, im Zusammenhang mit der Idee des höchsten Guts, untauglich ist, um die Mannigfaltigkeit dessen, was einem im Verlauf des Lebens widerfährt, vernünftig fassen zu können. Vieles deutet darauf hin, dass es zweckmäßiger wäre, anstatt vom glücklichen, vom guten Leben zu sprechen, denn in einem guten Leben hat das Glück zwar seinen Platz, greift aber nicht mehr Raum. So lautet die alles entscheidende Frage: Was ist ein gutes Leben? Eine erste Antwort findet sich – negativ formuliert – in den Motiven derselben: Ein gutes Leben ist ein solches, in dem die eigenen Gefühle, Wünsche und Zielvorstellungen widerspruchsfrei in einer richtunggebenden Ordnung stehen, die zugleich als ein sinnvolles Ganzes wahrgenommen wird, dem man von einer reflektierenden Warte aus zustimmen kann. Mit anderen Worten: Ein gutes Leben ist ein selbstbestimmtes Leben. Dabei muss man die Selbstbestimmung – formal gesehen – als die Fähigkeit deuten, sich selbst Gesetze zu geben, die man für richtig hält und entsprechend derer man handeln will; und man muss in der Lage sein, die Handlungen, welche diese Gesetze vorschreiben, in der Tat auszuführen. Doch ist ein derart ausgezeichnetes Leben überhaupt jemals zu erlangen? Für die antiken Skeptiker schon alleine deshalb nicht, weil es hierfür einer umfassenden Erkenntnis der Welt bedürfte, in der wir leben, sich diese Erkenntnisse aber prinzipiell nicht gewinnen lässt. Für Arthur Schopenhauer nicht, weil die Vorstellung vom guten bzw. geglückten Leben von Grund auf ein Irrtum ist. Diese, unsere Welt, ist schlicht und ergreifend nicht dafür eingerichtet, dass es uns erlaubt wäre ein gutes, mithin sinnerfülltes Leben zu führen. Wenn überhaupt, so zeigen sich die Splitter eines solchen Lebens nämlich nur dann, wenn Abwesenheit von Langeweile und Abwesenheit von Schmerz zusammenfallen. Dieses nämlich sind die Angelpunkte, zwischen denen sich unser Leben aufspannt. Entweder wir befinden uns in einem Mangelzustand, dem Zustand des Schmerzes, oder, wenn dieser Zustand durch Bedürfnisbefriedigung endlich beseitigt ist, im Zustand der Langeweile. Vom blinden, dumpfen Weltwillen angetrieben, hin und hergerissen zwischen den sich ständig aufdrängenden Bedürfnissen, der Befriedigung dieser Bedürfnisse und der daraus entspringenden, erbarmungslosen Öde, bleibt uns am Ende nichts anders übrig, als unser Heil in Albert Camus’ Sisyphos zu suchen: Einer Welt Sinn abringen zu wollen, in der es qua dessen, was sie ist, keinen Sinn gibt, ist absurd. Und in der Erkenntnis dieser Absurdität, im Bewusstsein des radikalen Nicht-Sinns, liegt das Moment der verschwiegenen Freude, jener Augenblick, in dem das Schicksal überwunden werden kann, in dem die Götter verachtet werden. Und doch: Wir müssen leben, weil wir wollen leben, sodass wir mit Friedrich Nietzsche zu Michel de Montaigne gelangen könnten, indem wir sagten: „Dass ein solcher Mensch geschrieben hat, dadurch ist wahrlich die Lust auf dieser Erde zu leben, vermehrt worden. […] Mit ihm würde ich es halten, wenn die Aufgabe gestellt wäre, es sich auf der Erde heimisch zu machen“ (Nietzsche, Friedrich: Unzeitgemäße Betrachtungen, de Gruyter, Berlin, 2015, S. 348). Vor dem Hintergrund der Negation bricht bei Montaigne DAS GROßE JA durch; ein vorbehaltloses Ja zum Leben:
Ja zum Lachen, denn das Besondere unseres Menschseins besteht darin, daß wir zugleich des Lachens fähige und lächerliche Wesen sind.
Ja zum Lesen, denn die Bücher bieten denen, die sie recht auszuwählen wissen, viele Annehmlichkeiten.
Ja zur Freundschaft und Geselligkeit, denn die Freundschaft bildet die Krönung der Gesellschaft.
Ja zum Reisen, denn die Verschiedenheit der Lebensweisen von einem Volk zum andern löst in mir nichts als Freude an solcher Vielfalt aus.
Ja zum Essen und Trinken, denn sie sind eine der wesentlichsten Verrichtungen unseres Lebens, und ein gutes Gastmahl ist ein festliches Vergnügen.
Ja zum Tanzen, denn die Grazie des Tanzes hängt nicht nur von der Bewegung der Füße ab, sondern auch von Liebreiz und Haltung der ganzen Person.
Ja zum maßvollen Genuß von Mode und Luxus, denn wenn man die Kleidung auf ihren eigentlichen Zweck zurückführn wollte, dem Körper und seiner Bequemlichkeit zu dienen, würde man erkennen, daß von daher ihre ursprüngliche Anmut und Angemessenheit stammt.
Ja zum vernünftigen Umgang mit Geld, denn Wohlstand und Bedürftigkeit hängen von der Einstellung jedes einzelnen ab.
Ja zum praxisbezogenen Philosophieren, denn die Philosophie hält ihre Lehren für jeden Menschen bereit, vom Kindesalter bis zum Wiederkindischwerden.
Ja zur eigenen Erfahrung, denn ob eines Kaisers oder eines einfachen Mannes Leben, stets ist es allem ausgesetzt, was Menschen begegnen kann.
Ja zum Schlafen und Träumen, denn ich glaube, daß Träume unsere Neigungen zutreffend interpretieren.
Ja zur Kultur und Kunstsinn der Wilden, denn es gibt keine bessere Schule für unsere Weiterbildung im Leben, als unseren Geist unausgesetzt die Mannigfaltigkeit so vieler anderer Daseinsweisen, Anschauungen und Gebräuche vorzuführen und ihn an diesem ewigen Wandel der Erscheinungsformen unserer Natur Geschmack finden zu lassen.
Ja zum Lehrmeister Tier, denn in den meisten ihrer Werke erweisen sich die Tiere als uns überlegen.
Ja zur Krankheit, denn wehzuklagen, weil einem etwas zustieß, das allen zustoßen kann, ist unangebracht, und überdies lassen uns die Krankheiten die Gesundheit umso dankbarer genießen.
Ja zu einer gelassenen Haltung gegenüber dem Tod, denn da es gute Todesarten für Narren gibt, und gute für Weise, machen wir doch solche ausfindig, die gut sind für die Menschen dazwischen! (De Montaigne, Michel: Von der Kunst das Leben zu lieben, Die Andere Bibliothek, Berlin, 2015, S. 14 f.)
Die Kolloquien der Academia Philosophia, zu deren Gründungsdirektoren ich gehöre, sind für alle Zeitgenossinnen und Zeitgenossen offen, die sich mit philosophischen Problem- und Fragestellungen beschäftigen wollen.
26.02.2019: Von der erlebten zur suprarationalen Zeit
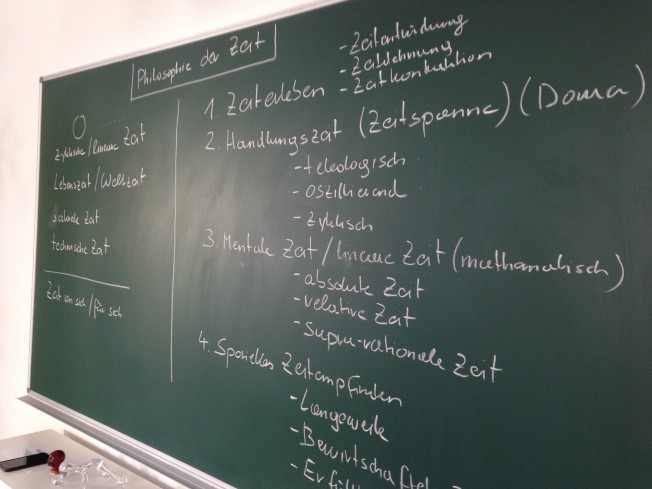
Die Zeit, so scheint es, ist ein fundamentales Bestimmungsstück, nicht nur des menschlichen, sondern allen Daseins überhaupt. Sein und in der Zeit sein, oder anders gesagt, Sein und irgendwann sein fallen offenbar unhintergehbar zusammen. Vor diesem Hintergrund brachte das Kolloquium zur Philosophie der Zeit einen wilden philosophischen Ritt durch die Denklandschaft der Zeitkonzeptionen, von der erlebten Zeit des Subjekts bis zur suprarationalen Zeit der Quantenwelt. Eine Rückschau in Abschnitten:
1) Die erlebte Zeit
Wie so oft in der Philosophie, so liegt der Ausgangspunkt der philosophischen Bemühungen auch in diesem Fall in einer Eigenart des Subjekts. Alle Zeit nämlich, so könnte man sagen, hebt mit dem Zeiterleben desselben überhaupt erst an. Es ist einigermaßen unzweifelhaft, dass jedenfalls einige unserer Erlebnisse Zeiterlebnisse sind, dass sie von Zeitempfindungen grundiert sind. Nicht immer treten diese Empfindungen in den Vordergrund, doch wer kennt sie nicht, die Zeit, die während eines aufregenden Gesprächs zu einem Punkt zusammenschrumpft und wie im Flug vergeht oder die Zeit, die sich endlos hinzieht, während wir das Ende eines langweiligen Konzerts ersehnen. Je nach persönlicher Konstitution – also der Einstellung und dem Verhalten zur Zeit –, momentaner Disposition – also der aktuellen Gemütsverfassung –, kulturspezifischer Situation – also dem Zeitverständnis eines Volkes –, inhaltlicher Bedeutung des Erlebten – also der Relevanz bzw. Irrelevanz des Erlebnisinhalts – und situativer Bedeutung für den Erlebenden – also der Beurteilung des Erlebten durch das Subjekt –, sind die Zeitempfindungen verschieden; sowohl für die einzelnen Subjekte selbst als auch im Verhältnis zu allen anderen Subjekten. Doch so verschiedenartig sie auch sein mögen, in ihnen müssen alle Zeittypen, mit denen wir in unserer Welt hantieren, ob in den Wissenschaften oder im Alltag, fundiert sein. Aus ihnen müssen sie sich letztlich herleiten lassen, denn eine andere Grundlage gibt es nicht. Die Welt, die uns gegeben ist, ist nämlich von vornherein eine empfundene, eine erlebte Welt.
2) Die Handlungszeit
Neben der erlebten Zeit zeigt sich zuallererst die Handlungszeit. Die Zeit geht nicht darin auf, nur erlebte Zeit zu sein; sie ist immer auch Handlungszeit, die auf bewussten, geplanten Handlungen des Subjekts aufruht. Die Handlungszeit ist reicher strukturiert als die kaum oder gar nicht strukturierte, diffuse Dauer der erlebten Zeit. Bei ihr handelt es sich entsprechend der Handlungsstruktur um eine gerichtete, also eine Richtung aufweisende, Zeitgestalt, die, vor allem im Vergleich mit der mathematischen Linearzeit, eine Reihe besonderer Merkmale aufweist:
Erstens ihre Konkretheit im Unterschied zu deren Abstraktheit: Die an eine spezifische Handlung gebundene Zeit ist stets konkret, und zwar insofern als es sich um genau jene Zeit handelt, die zur Durchführung der betreffenden Handlung erforderlich ist. Jede Handlung, oder allgemeiner formuliert jedes Geschehen hat daher seine eigene Zeit, die nur ihm allein zugehörig und mit der Zeit keines anderen Geschehens kompatibel ist.
Zweitens die Besonderheit im Unterschied zu deren Allgemeinheit: Die an den konkreten Inhalt einer Handlung gebundene Zeit ist genauso besonders und einzigartig wie der Inhalt selbst. Die Handlungszeit hat daher nichts zu tun, mit der von allem Inhalt abstrahierten, allgemeinen Linearzeit, in die alle Inhalte eingeordnet werden können.
Drittens die Qualität im Unterschied zu deren Quantität: Während sich die Linearzeit als eine Reihung homogener Teile in unendlicher Folge zeigt, zeigt sich die Handlungszeit als Ganzheit, die je nach Ausformung und Akzentuierung die Teile modifiziert.
Viertens die Endlichkeit im Unterschied zu deren Unendlichkeit: Da jede Handlung und jedes Geschehen einen Anfang und ein Ende haben, ist auch die daran gebundene Handlungszeit begrenzt. Sie ist, anders als die Linearzeit, endlich.
3) Die Mathematische Linearzeit
Die uns ohne Zweifel geläufigste Zeitform, die unser Leben in ein Korsett aus Sekunden, Minuten, und Stunden zwängt, ist die mathematische Linearzeit. Während die Form der Handlungszeit unhintergehbar an den konkreten Inhalt der Handlung oder des Geschehens gebunden und von diesem abhängig ist, werden Inhalt und Form nun getrennt. Die Zeit wird so aus dem Zusammenhang des Erlebens herausgelöst und auf diese Weise zu einem abstrakten, leeren Schema, in das beliebige konkrete Inhalte integrierbar sind. Sie wird mithin zu dem, was wir uns gemeinhin vermittelst einer Geraden verdeutlichen, also vermittelst einer unendlich langen und in beiden Richtungen unbegrenzten Linie. Jetzt, nach der Aufhebung der spezifischen Organisation der Zeitgestalten sowie deren Endlichkeit und Beschränktheit, mithin nach der Aufhebung ihres qualitativen Charakters, herrscht nicht nur durchgängige Strukturidentität – ist jeder Zeitteil dem anderen gleich –, sondern auch Kontinuität. Als unendliche, homogene, kontinuierliche Zeitreihe, mithin als bloße Quantität, bildet die Linearzeit die Grundlage der mathematisch messbaren Zeit, der mathematischen Linearzeit. Doch was damit einhergeht, ist bemerkenswert: Weil sämtliche Eigenschaften der Linearzeit ebenfalls Eigenschaften des (mathematischen) Raums sind, kommt es zu einer Verräumlichung der Zeit. Wegen der Abbildbarkeit und Darstellbarkeit aller Eigenschaften der Linearzeit im Raum klassifiziert man die Zeit auch als Raum-Zeit. Nichtsdestoweniger gibt es ein schwerwiegendes philosophisches Problem: Bezüglich der Zeit wird ein Richtungssinn behauptet, aufgrund dessen sie sich unumkehrbar in nur eine Richtung von der Vergangenheit in die Zukunft erstreckt. Für den Raum hingegen gilt das nicht. Ob man im Raum links beginnt und nach rechts übergeht oder umgekehrt, ist beliebig.
4) Newtons absolute Zeit
Die an die bisherigen Überlegungen zwangsläufig angrenzende Frage, ist die Frage nach dem ontischen Status der Raum-Zeit: Handelt es sich hierbei um etwas, was an sich selbst existiert, mithin absolut, oder um etwas, was bloß vermöge eines anderen existiert, mithin relativ?
Für Newton ist die Sache klar: Raum und Zeit existieren absolut. Es sind leere Behältnisse zur Datierung und Lokalisierung alles Seienden – immer gleich und unbeweglich verharrend, wie im Fall des Raums und gleichförmig fließend, wie im Fall der Zeit. So wie der Raum alle materiellen Körper enthält, so enthält die Zeit alle empirisch gefüllten Zeiten, Minuten, Stunden, Jahre usw. Weil sich aber weder der absolute Raum noch die absolute Zeit empirisch verifizieren lassen, sich das Ganze vom Standpunkt des endlichen Subjekts aus nicht in den Blick bekommen lässt, greift Newton in seiner Begründung auf ein unendliches Subjekt zurück: auf Gott. Absoluter Raum und absolute Zeit sind seiner Auffassung nach sensoria Gottes.
5) Kants transzendentale Zeit
Kant übernimmt zwar im Wesentlichen Newtons Raum- und Zeitsystem, beraubt es aber sowohl seines Absolutheitscharakters als auch seiner Fundierung in Gott. Raum und Zeit sind für Kant Anschauungsformen des menschlichen Subjekts, die ohne es nicht existieren. Doch diese Anschauungsformen sind deswegen nichts Erfahrungsindividuelles, sondern etwas Transzendentales. Es sind die allgemeinen Bedingungen der Möglichkeit von Erfahrung überhaupt. Sie liegen aller Erfahrung voraus, weshalb die Welt, die uns in der Erfahrung gegeben ist, unhintergehbar als räumlich und zeitlich erscheint.
6) Einsteins relativistische Zeitauffassung
In Einsteins berühmter Relativitätstheorie findet sich die mathematische Formulierung einer Zeitkonzeption, die die Kantische auf die Spitze treibt. Sie beschränkt sich nicht bloß auf die Relativität der Zeit zum Subjekt insgesamt, sondern sie löst das Subjekt in die Mannigfaltigkeit seiner Standpunkte auf, die es einzunehmen vermag. Einsteins Zeitkonzeption realisiert das Subjekt als einen Beobachter. Von hier aus werden Zeit, Raum und Bewegung relativistisch betrachtet. Es gibt kein absolutes Bezugssystem mehr. Schlechthin alles kann Bezugsystem sein. Das führt zwar zu einer Auflösung der Paradoxien der absoluten Zeit, aber mit weitreichenden Folgen: Das bestehen von Gleichzeitigkeit zwischen raumartigen Ereignissen hängt vom jeweils verwendeten Bezugsystem ab; ebenso wie die zeitliche Reihenfolge (nicht-kausaler) raumartiger Ereignisse. Die Einheit der Zeit, die objektive Anordnung aller Ereignisse in einem einheitlichen System, geht wegen der Abhängigkeit raumartiger Ereignisse vom subjektiven Bewusstsein verloren.
Die Labyrinthzeit der Quantenwelt
Nicht selten ist man im Zuge neuer Erkenntnisse über die Zusammenhänge in der Welt dazu gezwungen, lieb gewordene Konzepte über Bord zu werfen. Das trifft auf die Erkenntnisse über die Quantenwelt in besondrem Maße zu. Die bestehenden Zeitkonzepte, insbesondere die uns so vertraute Normalzeit, sprich mathematische Linearzeit, sind für eine Welt, in der eine vollständige und durchgängige Bestimmung der Objekte unmöglich, die durchgängige Identität derselben aufgehoben und das Band der Kausalität zerschnitten ist, samt und sonders ungeeignet. Die Welt zerfällt in ein Labyrinth aus Möglichkeiten, aus sich verzweigenden Pfaden, und niemand kann sagen, welche davon wo und wann realisiert werden. Eine suprarationale Weltauffassung. Eine Zeitkonzeption, die dieser Auffassung gerecht zu werden vermag, scheint ebenso suprarational: die sogenannte Labyrinthzeit – eine sich verästelnde Zeit; ein schwindelerregendes Netz auseinander- wie zusammenstrebender und paralleler Zeiten; ein Webmuster aus Zeiten, die sich einander nähern, sich verzweigen, sich scheiden oder einander jahrhundertelang ignorieren und das alle Möglichkeiten umfasst.
Literatur: Gloy, Karen: Zeit, Eine Morphologie, Verlag Karl Alber, Freiburg/München, 2017.
12.02.2019: Kolloquium zur Philosophie der Zeit

In seinem berühmten Traktat ›Von der Kürze des Lebens‹ schreibt der große stoische Zeitphilosoph Seneca: „Frage dich, was du in dieser langen Lebenszeit tatsächlich geleistet, wieviel dir von deinem Leben durch andere weggenommen worden, ohne daß du den Verlust gewahr wurdest, wieviel dir vergebliche Trauer, törichte Freude, unersättliche Begierde, der Reiz der Geselligkeit Zeit geraubt, wie wenig dir von dem Deinen geblieben – und du wirst einsehen, daß du stirbst, ehe du reif bist. Wie steht’s also damit? Ihr lebt, als würdet ihr immer leben; […] ihr habt nicht acht darauf, wieviel Zeit bereits vorüber ist; ihr verschwendet sie als wäre sie unerschöpflich […]“ (Seneca, Von der Kürze des Lebens, dtv, 2006).
Ohne Zweifel: Nichts bestimmt den Rhythmus des Lebens so sehr wie die Zeit. Man stiehlt sie uns, wir verlieren sie, wir begehren sie, wir verschwenden sie. Was aber ist die Zeit? Darüber wollen wir im ersten Kolloquium 2019 der Academia Philosophia nachdenken.
07.12.2018: Kolloquium zur Philosophie des Alters

Mit dem Kolloquium zur Philosophie des Alters, das am vergangenen Wochenende am wunderschönen Grundlsee stattfand, haben wir das philosophische Jahr der Österreichischen Akademie für Philosophie und philosophische Weltdeutung auf besonders freudvolle Weise abgeschlossen. Es war das erfolgreichste Jahr unserer Akademie, seit bestehen. Das liegt vor allem an den außergewöhnlichen Menschen, die die Philosophie weder irgendwelcher Zwecke wegen noch des Vergnügens wegen betreiben, sondern den bisweilen wilden Ritt über die karge Hochebene der philosophischen Abstraktion aus bloßer Freude am Denken antreten.
Eine Rückschau: Das Kolloquium zur Philosophie des Alters entpuppte sich, in seiner Gesamtheit, als ein Kaleidoskop der Blickwinkel. Obschon gleichsam überraschend, so doch im Grunde klar: Ein Blick ist immer ein Blick von irgendwo und dieses irgendwo ist im Falle des Alters ein Mannigfaltiges, denn man kann es nicht als ein absolutes betrachten – bekommt es stets nur als ein relatives zu Gesicht: relativ etwa zum Kindes-, Jugend- und Erwachsenenalter, zum Tod, zur Gesellschaft, zum Wünschenswerten oder zur Zukunft. Wollte man das Alter auf der biografischen Karte seines Lebens einzeichnen und ihm hierfür einen Namen geben – es scheint nämlich, als hätte es keinen –, so böte es sich an, die Metapher des Tageslaufs zu bemühen, um festzustellen, dass es der späte Nachmittag ist, die Zeit gegen Abend hin, mit der wir es zu tun haben. An diesem Punkt nämlich wandelt sich die Perspektive auf das Leben von Grund auf. Was lange ein prospektives Leben war, so Wilhelm Schmid, nach vorne offen und der Zukunft zugewandt, wird immer deutlicher zu einem retrospektiven Leben, nach vorne enger werdend und folglich der Vergangenheit zugewandt. Waren Alter, Sterben und Tod in jüngeren Jahren keine Denkkategorien, so drängen sich die betreffenden Gedanken nun von selbst auf. Die körperlichen und seelischen Erfahrungen tauchen unser Leben, in diesem letzten Phasenübergang, unhintergehbar in ein noch unbekanntes Licht. Dieses unbekannte Licht haben die Protagonisten unseres Kolloquiums mit ihrer ganz eigenen Deutung versehen:
Den Auftakt machte Marcus Tullius Cicero, der in seinem Vortrag ›Cato der Ältere über das Alter‹ gegen die weithin geläufige Auffassung argumentiert, dass sich das Alter zu nichts mehr gebrauchen lässt, weil es ihm an Aktivität mangelt, den Körper schwächt, uns nahezu sämtlicher Lüste beraubt und dem Tode nahe ist. Die Alten, so Cicero, tun natürlich nicht, was die Jungen tun, aber sie tun etwas viel Wichtigeres und Besseres. Große Dinge vollbringt man nämlich nicht durch körperliche Kraft, Wendigkeit und Schnelligkeit, sondern durch Planung, Geltung und Entscheidung; daran pflegt man im Alter nicht nur nicht abzunehmen, sondern gar noch zuzunehmen. Die Lust wiederum, mag sein, dass man sie im Alter verliert; doch gerade dies ist der Gewinn, ist sie doch die Feindin der Vernunft. Sie blendet die Augen des Geistes und verträgt sich überhaupt nicht mit der Tugend. Und die Nähe des Todes? Ganz platonisch gewendet ist sie nichts, was zu achten wäre, denn der Tod löscht die Seele entweder ganz aus – was folgt, ist ewiger traumloser Schlaf – oder er führt sie an einen Ort, wo ihr ewiges Leben, mithin Glückseligkeit, beschieden ist.
In Senecas Deutung wiederum bot sich das Alter über die weiteste Strecke als ein abstrakter, in der je eigenen Zukunft liegender, Standpunkt dar, der uns aber dennoch, sobald wir ihn einnehmen, wie ein wirklicher, dazu nötig, vor uns selbst Rechenschaft abzulegen, Antwort zu geben auf die Frage, ob wir mit der uns vergönnten Zeit auch sorgsam umgehen.
Bei Arthur Schopenhauer zeigte es sich – im Ausgang einer paradiesischen Kindheit, einer desillusionierenden Jugend und eines vom Streben nach Schmerzlosigkeit durchdrungenen Erwachsenenalters – als eine schicksalhafte Begegnung mit dem Tod, verbunden mit abnehmender Lebenskraft und einem Abgrund der Vergessenheit, in den immer größere Stücke des Erlebten hinabstürzen. Wie die Gegenstände auf dem Ufer, so Schopenhauer, von welchem man zu Schiffe sich entfernt, immer kleiner, unkenntlicher und schwerer zu unterscheiden werden; so unsere vergangenen Jahre, mit ihren Erlebnissen und ihrem Tun. Bisweilen glauben wir, uns nach einem fernen Orte zurückzusehnen, während wir uns eigentlich nur nach der Zeit zurücksehnen, die wir dort verlebt haben, da wir jünger und frischer waren. So täuscht uns alsdann die Zeit unter der Maske des Raums. Reisen wir hin, so werden wir der Täuschung inne.
Ernst Blochs Deutung zielte darauf ab, das Alter als eine Zeit der letzten Wünsche zu begreifen. Wünschenswerter als je zuvor sind jetzt Geld, Ernte und Ruhe. Geld aus dem neurotischen Haltetrieb zusammengekrallter Hände heraus, denen das Mittel völlig zum Zweck wird, als auch aus der Lebensangst eines invaliden Wesens heraus; Ernte aus dem Bedürfnis heraus, das Undeutliche oder nicht deutlich Gemachte des Gewinns, dieses so scharf erlebten Stufenwechsels, zu überwinden; und schließlich Ruhe aus dem Verlangen heraus vom Leben erschöpft sein zu dürfen.
Jean Amery hingegen suchte das Alter vom Blick der Anderen aus zu begreifen. Es ist ein Etikett, das einem die Gesellschaft umhängt, mit weitreichenden Folgen: Es gibt nämlich im Leben eines jeden Menschen einen Punkt, an dem erkennt, dass ihm die Gesellschaft den Kredit seiner Zukunft nicht mehr bewilligt, dass sie nicht mehr gewillt ist, sich darauf einzulassen ihn als den zu sehen, der er sein könnte. An diesem Punkt findet er sich als ein Geschöpf ohne Potentialität. Niemand fragt ihn mehr: Was wirst du tun? Alle stellen Fest, nüchtern und unerschütterlich: Das hast du schon getan. Die Anderen, so muss er jetzt erfahren, haben Bilanz gezogen und ihm einen Saldo vorgelegt, der er ist. Der Mensch ist, was er gesellschaftlich vollbringt, und der von der Gesellschaft als ein Alter diagnostizierter, dessen Vollbrachtes schon gezählt und abgewogen wurde, ist verurteilt.
Simone de Boauvoir schlug in dieselbe Kerbe, obschon aus einer anderen Richtung kommend. Auch bei ihr ist es die Gesellschaft, die dem Alter seine Stellung gibt, doch die Konsequenzen sind deutlich radikaler: es ist nämlich eine Stellung außerhalb der Menschheit. Der wesentliche Grund für diese Entmenschlichung der Alten liegt darin, dass unser kapitalistisches System den Menschen selbst als Produktionsmittel betrachtet und dort, wo er ein solches Mittel nicht mehr zu sein vermag, erlischt sein Wert. Die Wirtschaft, so Beauvoir, beruht auf Profit, ihm ist praktisch die ganze Zivilisation untergeordnet: Für das Menschenmaterial interessiert man sich nur insofern, als es etwas einbringt. Danach wirft man es weg.
Norberto Bobbios weniger philosophische als vielmehr ganz persönliche Bilanz über das Alter beschrieb die Welt der Alten als im Wesentlichen eine Welt der Erinnerung. Man sagt: Am Ende bist du das, was du gedacht, geliebt, vollbracht hast, und er fügt hinzu: du bist das, was du erinnerst. Würde man ihn aber fragen, um welche Art von Alter es sich bei seinem eigenen handelt, so würde er sagen: ein melancholisches Alter, wobei Melancholie als das Bewusstsein um das Unerreichte und das nicht mehr Erreichbare zu verstehen ist. Dem entspricht das Bild des Lebens als einer Straße, auf der das Ziel immer weiter in die Ferne rückt, und wenn du glaubst, es erreicht zu haben, war es nicht das, was dir als das endgültige Ziel vorschwebte. Das Alter wird dann zu dem Moment, in dem du die volle Klarheit darüber gewinnst, dass der Weg nicht nur nicht vollendet ist, sondern dass dir auch keine Zeit mehr bleibt, ihn zu vollenden, und dass du darauf verzichten musst, die letzte Etappe noch zu erreichen.
Odo Marquard verlegte gewissermaßen Schopenhauers Bestimmung der Kindheit, als die Zeit des Sehens, nicht des Wollens und also Tuns, ins Alter: Wer nichts mehr will, schreibt er, gewinnt – kompensatorisch – die Fähigkeit viel zu sehen. Hierauf stützt sich seine Kernthese, der zufolge das Alter in besonderem Maße theoriefähig ist. Theorie ist nämlich der Inbegriff des Sehens, das, was man macht, wenn man nichts mehr macht. Und das Alter wiederum ist jener Lebensabschnitt, in dem – aus zunehmendem Mangel an Zukunft – immer weniger und schließlich gar nichts mehr zu machen ist. Allerdings: die Theoriefähigkeit – die Illusionsresistenz – des Alters ist nicht ungefährdet. Die Gefahr kommt in liebenswerter Gestalt daher, den Enkelkindern. Die Alten wollen an der Zukunft junger Menschen teilnehmen und mit ihnen noch einmal alles Tun vor sich haben. Deshalb kommt es so leicht zur generationsüberspringenden Kumpanei zwischen Großeltern und Enkeln. Den jüngeren Enkeln stecken sie süße Bonbons zu und den älteren süße Weltanschauungen, der Preis für die Wiederholung einer Zukunft, die unwiederbringlich verloren ist.
Moritz Schlick endlich, der Gründervater des berühmten Wiener Kreises, jenes philosophischen Zirkels am Beginn des 20. Jahrhunderts, dessen Mitglieder die Metaphysik auf den Misstaufen der Geschichte und die Philosophie, wie so viele vor ihnen, auf wissenschaftliche Beine stellen wollten, dessen Vortrag über den Sinn des Lebens den Schlusspunkt unseres Kolloquiums setzte, betrachtete das Alter vom Standpunkt des Lebenssinns aus. Ob es einen Sinn hat oder nicht, kommt darauf an, ob es sich den Geist der Jugend zu bewahren vermochte. Der Geist der Jugend: das ist, in philosophischer Bedeutung, der tätige Umgang mit der Welt in Abwesenheit der Zwecke. Das wahre Wesen der Jugend liegt nämlich nicht darin, dass sie Vorspiel und erste Phase des Lebens ist, sondern vielmehr darin, dass sie die Zeit des Spiels ist, d. h., die Zeit des schöpferischen Tätigseins aus bloßer Lust am Tun. Noch nicht gefangen im Netz der Zwecke, in welches sich die Erwachsenen, angetrieben von der Notwendigkeit des Broterwerbs, verstricken, ist das Handeln ein Spiel, ein selbstgenügsames Tun, dem sein Wert unabhängig vom Zweck zukommt. Daraus folgt aber, dass die Jugend in unserem philosophischen Sinne durchaus nicht auf die frühen Stadien des Lebens beschränkt bleiben muss, sonder überall dort anzutreffen ist, wo der Zustand des Menschen einen Gipfel erreicht hat, wo sein Handeln zum Spiel geworden, wo er ganz dem Augenblick und der Sache hingegeben ist. Das Alter also ist, wie das Leben insgesamt, vom Sinn dieses Lebens nicht abgeschnitten, doch es bedarf der Befreiung aus der Tyrannei der Zwecke. Die letzte Befreiung des Menschen überhaupt wäre erreicht, wenn er in all seinem Tun sich ganz dem Handeln selber hingeben könnte, immer von der Liebe zu seiner Tätigkeit beseelt. Dann würde nie der Zweck die Mittel heiligen und alles Leben wäre bis in seine letzten Verzweigungen wahrhaft sinnvoll. Leben hieße: das Fest des Daseins feiern. Und Freude wäre – auch im Alter – wo sonst nur Vergnügen ist, jene flache Lust, die das leere Angesicht der Sterblichen glättet und dem Dasein einen falschen Putz gibt.
19.11.2018: Das Wagnis Philosophie

Soeben kehre ich aus Wien zurück; noch in Gedanken bei den Absolventinnen und Absolventen des diesjährigen Studiengangs zu den Grundlagen der abendländischen Philosophie; diesem außerordentlichen Denkabenteuer; diesem wilden Ritt über die Hochebene der philosophischen Abstraktion.
Die Philosophie vermag es einen in ihren Bann zu ziehen, wenn man hartnäckig genug ist und das Wagnis eingeht, den festen Boden der Alltagsrealität zu verlassen. Sobald man sich nämlich aufmacht, das Selbstverständliche – und darum Unverstandene – aus seiner Selbstverständlichkeit herauszulösen,
lassen sich selbst die scheinbar einfachsten Fragen nur noch sehr schwer beantworten. Und mit der Praxis unseres Lebens haben diese Fragen nur noch wenig oder gar nichts mehr zu tun. Doch man darf sich nicht abschrecken lassen. Für diejenigen nämlich, die hinter die Kulissen blicken wollen, die sich nicht zufriedengeben mit dem oberflächlichen Getöse der Welt, das uns die Welt als trivial und selbstverständlich erscheinen lässt, gibt es keine andere Wahl.
Der Lohn der Mühe: das Antlitz der spröden Schönheit des philosophischen Nachdenkens und diese wunderbare Distanz zur Alltagsrealität, die einem ihr Gezeter für einen kurzen Augenblick vergessen macht und den Duft der Freiheit trägt.
13.11.2018: Die Philosophie als theoretische Disziplin

“Meiner Meinung nach […] ist alle Philosophie immer theoretisch, indem es ihr wesentlich ist, sich, was auch immer der nächste Gegenstand der Untersuchung sei, stets rein betrachtend zu verhalten und zu forschen, nicht vorzuschreiben. Hingegen praktisch zu werden, das Handeln zu leiten, den Charakter umzuschaffen sind alte Ansprüche, die sie bei gereifter Einsicht endlich aufgeben sollte. Denn hier, wo es den Wert oder Unwert des Daseins, wo es Heil oder Verdammnis gilt, geben nicht ihre toten Begriffe den Ausschlag, sondern das innerste Wesen des Menschen selbst, der Dämon, der ihn leitet und der nicht ihn, sondern den er selbst gewählt hat — wie Platon spricht, sein intelligibler Charakter — wie Kant sich ausdrückt. Die Tugend wird nicht gelehrt, so wenig wie der Genius: ja für sie ist der Begriff so unfruchtbar und nur als Werkzeug zu gebrauchen, wie er es für die Kunst ist. Wir würden daher ebenso töricht sein zu erwarten, daß unsere Moralsysteme und Ethiken Tugendhafte, Edle und Heilige, als daß unsere Ästhetiken Dichter, Bildner und Musiker erweckten.
Die Philosophie kann nirgends mehr tun als das Vorhandene deuten und erklären, das Wesen der Welt, welches in concreto, d. h. als Gefühl, jedem verständlich sich ausspricht, zur deutlichen, abstrakten Erkenntnis der Vernunft zu bringen, dieses aber in jeder möglichen Beziehung und von jedem Gesichtspunkt aus” (Schopenhauer, Arthur: Die Welt als Wille und Vorstellung, Band 1, Suhrkamp, Frankfurt am Main, 2015, S. 375 f.).
16.10.2018: Beginn des Studiums extramurale

Soeben bin ich aus Wien zurückgekehrt, wo an der Österreichischen Privatakademie für Philosophie und philosophische Weltdeutung zum bereits sechsten Mal das Studium extramurale anhob. Dabei handelt es sich um ein insgesamt zehntägiges Studium der Grundlagen der Philosophie; konzipiert für jene Menschen, die eine fundierte Einführung in die philosophischen Wissenschaften erfahren wollen, ohne sich aber hierfür den Zwängen und Anforderungen eines Universitätsstudiums aussetzen zu müssen.
Nach einer ersten Begegnung mit den Kerndisziplinen der Philosophie – Logik, Erkenntnistheorie, Metaphysik und Ethik – und dem Versuch die Philosophie als die Wissenschaft von den allgemeinsten Wahrheiten und den letzten Gründen zu etablieren, haben wir zunächst eine zweitägige Zeitreise unternommen, die uns von der Philosophie der Vorsokratiker bis zur Philosophie des 20. Jahrhunderts führte.
Im Anschluss an diesen Überblick über die zweitausendsiebenhundertjährige Geschichte der Philosophie widmeten wir uns, an weiteren zwei Tagen, einem der wichtigsten Werkzeuge des philosophischen Denkens überhaupt: der Logik. Neben den Besonderheiten der allgemeinen Namen- und Satzlehre, die der logischen Präzisierung der Sprache und insofern der logischen Präzisierung des Denkens dient, interessierte uns im Zusammenhang mit der klassischen Logik vor allem das Vehikel des Arguments: Argumente sind sprachliche Repräsentanten der Inhalte bestimmter Denkvorgänge, nämlich der des Schließens. In einem Schluss wird von irgendwelchen Behauptungen auf irgendwelche anderen Behauptungen übergegangen, sodass die entscheidende Frage lautet: Inwiefern ist dieser Übergang gerechtfertigt oder besser gesagt folgerichtig? Auf die Argumentebene umgelegt: Wann ist ein Argument gültig? Ein Argument ist gültig genau dann, wenn die Konklusion des betreffenden Arguments logisch aus seinen Prämissen folgt. Die Konklusion des betreffenden Arguments folgt logisch aus seinen Prämissen genau dann, wenn es logisch unmöglich ist, dass alle Prämissen des betreffenden Arguments wahr und zugleich seine Konklusion falsch ist. Die große Stärke der Logik liegt nun darin, dass sie von allem Inhalt absehen kann. Die Folgerichtigkeit bzw. Gültigkeit von Argumenten hängt nämlich ausschließlich von der Form eines Arguments ab, nicht vom semantischen Gehalt (– vom Bedeutungsgehalt –) der darin vorkommenden Aussagen. Mit der Methode der Wahrheitstafel haben wir darüber hinaus ein aussagenlogisches Kalkül kennengelernt, das es uns erlaubt von jedem beliebigen, logisch gültigen Argument, das die Aussagenlogik zu behandeln vermag, zu zeigen, dass es logisch gültig ist.
Der letzte Tag des ersten Abschnitts hat uns in die Erkenntnistheorie geführt. Einer der wichtigsten Begriffe der Erkenntnistheorie ist der des Wissens und so haben wir uns über die weiteste Strecke mit der Frage beschäftigt, was wissen ist. Unsere Bemühungen hierüber Auskunft zu erhalten erstreckten sich entlang des Versuchs, dem Wesen des Wissens auf die Spur zu kommen; mithin eine Realdefinition des Wissensbegriffs vorzulegen, die allen Angriffsversuchen standhält. Dieser Definition nach weiß S, dass p genau dann, wenn S überzeugt ist, dass p, S gute Gründe hat überzeugt zu sein, dass p und p wahr ist. Eine Definition, die auf Platon zurückgeht und bis ins 20. Jahrhundert für befriedigend gehalten wurde. Bis der US-amerikanische Philosoph Edmund Gettier auf den Plan trat und zeigte, dass es Fälle gibt, in denen zwar alle Bedingungen für Wissen erfüllt sind, aber nichtsdestoweniger kein Wissen vorliegt.
17.09.2018: Kolloquium ›Wiener Kreis‹

Am vergangenen Wochenende, also vom 15.09-16.09.2018, ging das zweite Kolloquium der Academia Philosophia über die Bühne. Das Thema: Wiener Kreis.
Im Kolloquium ›Wiener Kreis‹ haben wir uns auf die Spuren jenes weltberühmten Philosophenzirkels begeben, der die Philosophie im ersten Drittel des 20. Jahrhunderts auf drastische Weise zu erneuern suchte. Inmitten der Wirren der Zwischenkriegszeit etablierte sich in Wien, um Moritz Schlick, Rudolf Carnap, Viktor Kraft, Ludwig Wittgenstein u. a. m., von 1924-1936 die philosophische Denkrichtung des logischen Empirismus. Die radikale Position, die sich dahinter verbirgt, zeigt sich vor allem in der Auffassung, dass sinnvolle wissenschaftliche Sätze, d. h. Sätze, die theoretisch gehaltvoll sind, ausschließlich solche sind, die auf sinnlich Wahrnehmbares zurückgeführt werden können, also Sätze der Erfahrungswissenschaften. Was nicht auf Erfahrung zurückgeführt werden kann, für das kann ein Sinn überhaupt nicht angegeben werden. Sämtliche Metaphysik wird daher von den Mitgliedern des Wiener Kreises, wenn auch mit unterschiedlicher Strenge, als unhaltbare Spekulation, als bloße Denkakrobatik mit Scheinsätzen, die nur so aussehen als wären sie sinnvolle Sätze, zurückgewiesen. Doch es ist nicht nur die Metaphysikfeindlichkeit und die sich daraus ergebende Überhöhung der Erfahrungswissenschaften, die den Wiener Kreis zu einer so polarisierenden Strömung, und, nebst hergesagt, auch zum Feindbild des aufkeimenden Austrofaschismus und Nationalsozialismus, machten, sondern vor allem, die damit verbundene, und von vielen als eine totale Zerstörung der Philosophie wahrgenommene, Neuordnung des philosophischen Denkens: Die Philosophie ist nämlich dieser Neuordnung nach, die in den sagenumwobenen Donnerstagssitzungen des Kreises ihre Durchführung fand, keine Wissenschaft, sie trägt nichts zum Wissen über die Welt bei, was daran liegt, dass nicht nur metaphysische Aussagen, sondern alle philosophischen Aussagen insgesamt, das vom Wiener Kreis genuin hervorgebrachte, und oben kurz angerissene, sogenannte Sinnkriterium nicht erfüllen. Die Aussagen der Philosophie sind selbst sämtlich ohne theoretischen Gehalt, bzw., in der Sprechweise des Wiener Kreises gesagt, sinnlos. Dementsprechend liegt die Aufgabe, oder anders gesagt, das eigenständige Feld der Philosophie ausschließlich darin, die wissenschaftliche Erkenntnis der Einzel- mithin Erfahrungswissenschaften auf ihre logische Struktur hin zu untersuchen. Das heißt zu untersuchen, wie ihre Begriffe und Aussagen untereinander logisch zusammenhängen, wie Begriffe in anderen eingeschlossen sind, wie Aussagen sich auseinander ableiten lassen und dergleichen mehr. Das ist die andere, die logische, Seite des logischen Empirismus. Philosophie besteht in nichts anderem als in der logischen Analyse der Sprache. Sie ist, um erneut einen Ausdruck des Wiener Kreises zu gebrauchen, Wissenschaftslogik. Im Ausgang der Bemühungen des Wiener Kreises kommt es einerseits, vor allem in der akademischen Philosophie des angloamerikanischen Raums und Großbritanniens, zum sogenannten linguistic turn, zu einer verstärkten Beschäftigung mit der Sprache; andererseits zum Auskristallisieren dessen, was wir heute ›Analytische Philosophie‹ nennen.
26.07.2018: Immanuel Kant – Buchneuerscheinung

Immanuel Kants Hauptwerk, die ›Kritik der reinen Vernunft‹, gehört nicht nur zu den großen Klassikern philosophischer Literatur, sondern ist ohne Zweifel auch eines der wirkmächtigsten in der Geschichte der Philosophie. Nichtsdestoweniger ist es schwer zugänglich und ohne fundierte philosophische Kenntnisse kaum zu verstehen. In dem hier vorliegenden Studienbuch habe ich daher den Versuch unternommen, die wesentlichen Stränge dieser so fundamentalen Weltdeutung, als einen Grundriss derselben, herauszuarbeiten und auf diese Weise in das intellektuelle Vermächtnis Kants einzuführen.
18.06.2018: Philosophie der Generationen

Jean-Jacques Rousseau, der große französische Philosoph und Aufklärer, war der Auffassung, die Jugend sei die Zeit, Weisheit zu lernen, das Alter hingegen die Zeit, sie auszuüben. Ein Ideal, das die Generationen auf schlechthin wundersame weise verbinden könnte. Doch in unserer betriebsamen Alltags- und Berufswelt kommen wir diesem Ideal nur selten nahe. Wie oft weist die Jugend, ungestüm und vor Kraft strotzend, allen Beistand der Alten zurück; und wie oft ist es nicht die Weisheit, welche die Alten treibt, sondern bloße Eitelkeit. In unserer Debatte über die Jugend und das Alter wollen wir dieser fragilen Beziehung der Generationen auf den Grund gehen. Was sind die Besonderheiten der Jugend und was die des Alters? Und wie lasen sich diese beiden – scheinbar unvergleichlichen – Lebensabschnitte gedeihlich zueinander in Beziehung setzen? Eine Betrachtung in drei Gedankensplittern.
Zu finden in der Rubrik ›Publikationen‹ und hier wiederum unter ›P‹ wie Philosophie der Generationen.
13.06.2018: Sommerakademie der Academia Philosophia

Die Sommerakademie 2018 der Academia Philosophia in Castefranco di Sopra, Toskana, Italien, ist Geschichte. Eine Geschichte, die vor allem von den Sommerakademikerinnen und Sommerakademikern erzählt wurde – mithin von den Freundinnen und Freunden der Academia Philosophia –, großartig ausgeschmückt und in bunten Farben gezeichnet, facettenreich und unvergesslich, und in deren Zentrum zwei außergewöhnliche und berühmte Philosophen standen: Immanuel Kant und Jean-Paul Sartre. Der eine der Begründer des transzendentalen Idealismus, der andere des Existenzialismus. Ein ungleiches Paar, obschon das Studium gezeigt hat, dass es nichtsdestoweniger eine gemeinsame Klammer gibt: die Kontingenz der Erfahrungswirklichkeit und der andauernde aber stets scheiternde Versuch des Menschen, sie zu überwinden.
Die Welt Immanuel Kants ist gleichsam eine Welt mit zwei Seiten: Auf der einen Seite ist sie Vorstellung, mithin Phänomenwelt: eine, den subjektiven Bedingungen der Anschauung nach, a priori in Raum und Zeit gegebene, durch apriorische Regeln des Verstandes aufgebaute und durch ebendiese Regeln gesetzmäßig geordnete, Welt objektiver Erfahrung, die wir gemeinhin ›Natur‹ nennen; deren radikale Kontingenz, entlang der transzendentalen Ideen der reinen Vernunft, als einem System von bloß gedachten, letzten Gegenständen, aufgehoben und uns auf diese Weise als ein stetes, in sich geschlossenes, Ganzes begreiflich wird. Auf der anderen Seite wiederum ist sie eine Welt der Dinge an sich; eine Welt transzendentaler Objekte, ohne deren Dasein nämlich weder Anschauungsvermögen noch Verstand noch Vernunft, mithin überhaupt kein Erkenntnisvermögen in uns, zur Ausübung erweckt werden würde. Denn wie sonst sollte dies geschehen, so Kant, wenn nicht durch Gegenstände, die unsere Sinne rühren und teils von selbst Vorstellungen bewirken, teils unsere Verstandestätigkeit in Bewegung bringen, diese zu vergleichen, sie zu verknüpfen oder zu trennen, und so den rohen Stoff sinnlicher Eindrücke zu einer Erkenntnis der Gegenstände zu verarbeiten, die Erfahrung heißt? Mithin: Ohne eine Welt der Dinge an sich, keine Welt für uns. Doch mit der Welt der Dinge an sich ist zugleich eine Hinterwelt eingeführt, die maximal transzendent, mithin unerkennbar, ist. Denn das, was in der Erfahrung unmittelbar vorliegt, ist immer schon etwas anderes, als das, was ihm vorhergeht; ist immer schon ein vom Subjekt gestaltetes, konstruiertes; immer schon ein Für-uns, niemals aber ein An-sich.
Auch Jean-Paul Sartres Welt ist gewissermaßen eine Zweiseitenwelt. Eine Welt des An-sich-sein und des Für-sich-sein. Während das An-sich-sein ist, was es ist, also mit sich selbst identisch und undurchdringlich, voll von sich selbst, gesättigt und bezugslos, und insgesamt dasjenige repräsentiert, was wir gemeinhin die kausale Welt physischer Einzeldinge nennen, ist das Für-sich-sein nicht, was es ist, verweist es stets auf ein anderes, als es selbst ist und ist gerade deshalb selbst nichts. Die Rede ist vom Bewusstsein. Bewusstsein ist nämlich immer Bewusstsein von etwas und ohne es ist es nichts. So ist das Sein des Bewusstseins, das Für-sich-sein, auch nur erborgt, denn es hängt am An-sich-sein als seinem unhintergehbaren Bezugspunkt. Alles Sein aber ist insgesamt kontingent, nicht notwendig, mithin überflüssig, ja letztlich bedeutungslos. Es ist, wie Sartre sagt, in nichts gegründet. Das trifft auf das Dasein der physischen Einzeldinge in gleicher Weise zu, wie auf das Dasein des Menschen. Wir sind, so könnte man sagen, ebenso überflüssig wie Steine, Bäume oder die ganze Heerschar aller Sterne im Universum. Doch dieser ins Bewusstsein durchklingende Tatbestand ist uns, im Unterschied zum bloß physischen Dasein, nicht gleichgültig, weshalb sich das Sein, in seiner menschlichen Ausprägung, unablässig zu gründen sucht. Aufruhend auf der Freiheit des Menschen, die sich in der Fähigkeit des Fragens offenbart und uns in die Lage versetzt uns von der physischen Welt loszureißen, mithin Stellung zu beziehen, sie vor uns zu bringen und durch den Akt der Nichtung – der dem Fragen innewohnt – eine je eigene Ordnung zu schaffen, sind wir, ontologisch gesehen, dazu genötigt, den Zustand zwischen Sein und Nichts, zwischen An-sich- und Für-sich-sein zu überwinden, um endlich auf sicherem Grund zu stehen. Das Vehikel zu diesem Grund aber ist der Andere. In dem wir uns nämlich, vermittelst der eigenen Freiheit, der Freiheit des Anderen zu bemächtigen und sie zu kontrollieren suchen, suchen wir uns auf diese Weise in ihm zu gründen. Doch erst im radikalen Scheitern dieser Gründung, mithin in der Unmöglichkeit des An-und-für-sich-seins, zeigt sich die ganze Tragik menschlicher Existenz als eines andauernden – letztlich von Angst begleiteten – ekstatischen Zustands, eines andauernden Außer-sich-seins. An diesem Punkt erhebt sich dann zu guter Letzt auch die Idee Gottes. Als Inbegriff des An-und-für-sich-seins ist Gott der ins jenseits projizierte Wunsch des Menschen nach Gründung. Mensch sein bedeutet für Sartre daher nichts anders als danach zu streben, Gott zu sein.
14.05.2018: Jean-Luc Picard – Philosophie der Zeit

Ein kleine Philosophie der Zeit des Herrn Jean-Luc Picard, seines Zeichens Oberbefehlshaber der Enterprise und einer der herausragendsten Captains der Sternenflotte des 24. Jahrhunderts:
„Jemand hat mir einmal gesagt, die Zeit würde uns, wie ein Raubtier, ein leben Lang verfolgen. Ich aber möchte viel lieber glauben, dass die Zeit unsere Gefährtin ist, die uns auf unserer Reise begleitet und uns daran erinnert, jeden Moment zu genießen, denn er wird nicht wieder kommen.“
Einschränkend ist lediglich hinzuzufügen, dass der Genuss der Momente wohl nur für jene gelten kann, die dem Genuss prinzipiell zugänglich sind, denn es wird in einem Menschenleben, ohne Zweifel, auch Momente geben, die, obschon bisweilen von entscheidender Bedeutung, des Genusses unzugänglich sind.
16.04.2018: Sinnentleerte Entschuldigungen

Es vergeht kein Tag an dem sich nicht irgendjemand – zumeist medienwirksam öffentlich – entschuldigt. Politikerinnen und Politiker entschuldigen sich für ihr skandalöses Verhalten, Unternehmen entschuldigen sich für ihre Betrügereien, Prominente entschuldigen sich für dumme Aussagen. Aber auch weniger spektakulär inszenierte Entschuldigungen finden auf mannigfaltige weise statt: wir entschuldigen uns fürs Zuspät- oder Garnichtkommen, fürs nicht Zurückrufen, für Irrtümer, für Fehler, für die falsche Wortwahl, für eine andere Meinung und wer weis wofür nicht sonst noch alles. Wir sind eine Entschuldigungsgesellschaft!
Doch leider ist festzustellen, dass es dieser Gesellschaft zusehends an semantischem Gespür mangelt, was zur Folge hat, dass der Begriff der Entschuldigung – und im Übrigen nicht nur dieser – zu einer Sprachruine verkommt, zu einem ganz sinnentleerten, abgewrackten Stück Sprache. Das ist insofern dramatisch als dieser Begriff, an und für sich genommen, ein wertvolles, weil gewichtiges, Instrument einer jeden moralisch integren Gesellschaft darstellt. Vom Einzelnen – behutsam – richtig gebraucht, ist er nämlich Ausdruck von Einsicht, von Empathie und der Hoffnung auf Vergebung.
Worin liegt die Schwierigkeit? Nun: Erstens fehlen nicht selten der Adressat der Entschuldigung und bisweilen auch das Objekt derselben. Wer sich entschuldigt, der kann sich sinnvollerweise nur bei jemandem für etwas entschuldigen. Sich bei niemandem für nichts zu entschuldigen, ist sinnlos. Denn, was will denn mit einer Entschuldigung anderes erreicht sein, als sich zu entschulden? Eine Schuld aber ist in moralischer Hinsicht immer eine Schuld gegenüber jemandem im Hinblick auf etwas. Und zweitens findet sich gerade hier das eigentliche Moment der fortschreitenden Begriffserosion: Über weite Strecken nämlich entschuldet man sich – bei wem auch immer und für was auch immer – selbst. „Ich entschuldige mich!“ tönt es heroisch landauf landab. Doch wer so redet, der weiß nicht, was er sagt; mit fatalen Folgen. Wer sich nämlich etwas zuschulden kommen lässt und diese Schuld gleichsam in einem Akt der Selbstabsolution, also durch das ›Ich entschuldige mich!‹, aufhebt, der zerstört nicht nur den Sinngehalt des Begriffs der Entschuldigung, führt ihn sozusagen ad absurdum, sondern auch die moralische Integrität einer Gesellschaft.
Niemand kann sich selbst entschulden. Das ist das konzeptionelle Rückgrat dieses Begriffs und es verweist auf einen Gerichtshof, dem man in der betreffenden Angelegenheit nicht selbst vorsteht. Nur unter dieser Voraussetzung ist und bleibt die Entschuldigung eine sinnvolle moralische Institution. Entschulden kann einen immer nur der Andere. Und die adäquate Formel ist daher auch die der Bitte, denn erst der Zusammenklang eines so aufgefassten Begriffs der Entschuldigung mit der Bitte um eben dieselbe offenbart ihren eigentlichen moralischen Wert: Einsicht, Empathie und Hoffnung auf Vergebung.
23.03.2018: Neues aus der Academia Philosophia

Noch nie in der Geschichte der Academia Philosophia waren zu einem so frühen Zeitpunkt des Jahres nahezu alle Veranstaltungen bis auf den letzten Platz gefüllt. Lediglich für das 10-tägige Studium extramurale, in dem wir uns mit den Grundlagen der Philosophie, insbesondere mit ihren Kerndisziplinen, beschäftigen, sind noch Plätze frei. Details & Anmeldung
Aus diesem Grund haben wir uns dazu entschieden, bereits jetzt die Kolloquien für das Jahr 2019 online zu stellen. Wir denken ein sehr schönes und philosophisch ansprechendes Programm für Sie bereitzuhalten:
Den Anfang machen wir – im Februar 2019 – mit dem Kolloquium “Philosophie der Zeit”, Ort: Academia Philosophia, Wien
Details & Anmeldung
Anschließend beschäftigen wir uns – im September 2019 – mit der Philosophie des Bewusstseins,
Ort: Academia Philosophia, Wien
Details & Anmeldung
Und beenden das Jahr – im Dezember 2019 – mit dem Kolloquium zur “Philosophie der Revolution”.
Ort: Seehotel Grundlsee
Details & Anmeldung
26.02.2018: Kolloquium ›Personale Identität‹

Am vergangenen Wochenende, also von 24.02-25.02.2018, ging die Auftaktveranstaltung des philosophischen Jahres der Academia Philosophia über die Bühne. Das Thema: personale Identität.
Die Frage nach personaler Identität lässt sich mit dem deutschen Philosophen Robert Spaemann auf den Punkt bringen: Worin liegt der Unterschied, zwischen etwas und jemand? Eine Frage, die im ersten Moment trivial erscheint, denn nichts deucht uns einfacher als zwischen bloßen Gegenständen und uns selbst, als dem Inbegriff des Personseins, zu differenzieren. Doch wie bei so vielem in dieser Welt hebt sich die Trivialität auch in diesem Fall sofort auf, sobald man das zergliedernde Skalpell des philosophischen Denkens anlegt und nach den nicht-trivialen Voraussetzungen vermeintlich trivialer Zusammenhänge forscht. Denn worüber reden wir eigentlich, wenn wir von personaler Identität reden, von Personen, vom Personsein, mithin von einem sich durch alle Veränderungen durchhaltenden, also selbst unveränderlichen, Drehpunkt, der es uns erlaubt, uns selbst jederzeit als denselben zu begreifen? Mit unseren philosophischen Überlegungen zu einer Theorie der konkreten Einzeldinge (Substratumtheorie, Bündeltheorie und Substanztheorie), zu einer adäquaten Zeitkonzeption (Präsentismus und Eternalismus) und, auf alledem aufruhend, zu den Konzeptionen personaler Identität (körperliche, mentale und einfache Konzeption) haben wir im Kolloquium ›Personale Identität‹ den Versuch unternommen diesen so fundamentalen Aspekt unserer Existenz (und womöglich der Existenz noch anderer Wesen) auszuleuchten.
19.01.2018: Academia Philosophia, Termine 2018

Die Philosophie hat alles, um im besten Fall nichts mit ihr zu tun zu haben: Sie ist theoretisch, nicht praktisch; sie ist lebensfern, nicht lebensnah und die Beschäftigung mit ihr ist überaus schwierig. Mit der Leichtigkeit des Seins hat sie nichts zu tun. Es gibt nur zwei mögliche Bewegungen, so der französische
Philosoph und Seismograf des Verfalls Emil M. Cioran: heilsame Illusion oder unerträgliche Wahrheit. Letztere ist ihr Geschäft. Welt und Mensch am Seziertisch des Denkens. Unter dem Philosophenhammer bleibt nichts heil. Vielleicht aber ist sie gerade deshalb so anziehend, so schillernd, so faszinierend, so tief; lässt sie einen nicht mehr los.
Das philosophische Jahr der Academia Philosophia bietet eine ganze Reihe von Möglichkeiten, die Räume des Existierenden und Nichtexistierenden auszuleuchten:
Kolloquium “Personale Identität”, Was macht uns zu Personen?, 2 Tage, Wien
Details & Anmeldung
Kolloquium “Wiener Kreis”, Denken am Rande des Abgrunds, 2 Tage, Wien
Details & Anmeldung
Kolloquium “Philosophie des Alters”, Vom Umgang mit dem Alter, 2 Tage, Grundlsee (Salkammergut)
Details & Anmeldung
Studium extramurale: Einführung in die Grundlagen der Philosophie (Geschichte der Philosophie, Erkenntnistheorie, Logik, Metaphysik, Ethik)
Details & Anmeldung
22.12.2017: Statt Weihnachten eine Regierung

Angesichts der Brisanz der politischen Entwicklungen in diesem Land scheint es vernünftig Weihnachten abzusagen und anstatt dieser heilsamen, wenn auch durch und durch ideologisch kontaminierten, Illusion anheimzufallen, in den Abgrund unerträglicher Wahrheit zu blicken und auf allen nur erdenklichen Wegen diesen logischen Fehler aufzudecken, der uns in die Irre führt und uns glauben macht, dass das, was die Vielen für gut halten, notwendig gut ist. Ein übler Fehlschluss, der uns von jeher auf die Schlachtfelder dieser Welt treibt, welche auch immer es sein mögen. Nun ist es aber so, dass dem Philosophen darüber hinaus alles fehlt, um wirkliches politisches Geschehen zu kommentieren, wenn es nicht darauf hinauslaufen soll, bloß die eigene Meinung anzupreisen, auf die man getrost verzichten kann. Will er aber hierzu trotzdem etwas sagen, so muss er beim Literaten Zuflucht nehmen; nicht bei irgendeinem, sondern beim Meister der Übertreibungskunst, der mit dieser Übertreibungskunst alles übertreibt und gerade deshalb, also gerade weil er mit dieser Übertreibungskunst alles übertreibt, im vollkommen von dieser Übertreibungskunst Übertriebenen sichtbar wird, was ansonsten, hinter dem erkünstelten Schein des Alltäglichen, unsichtbar bliebe:
„Wir haben die widerwärtigste Regierung, die man sich nur vorstellen kann, die verheucheltste, die boshafteste, die gemeinste und gleichzeitig die dümmste, sagen wir, und es stimmt natürlich, was wir denken und wir sagen das ja auch alle Augenblicke, sagte Reger, aber wenn wir aus diesem niedrigen verheuchelten und bösartigen und verlogenen und dummen Land hinausschauen, sehen wir, daß die anderen Länder genauso verlogen und verheuchelt und alles in allem genauso niedrig sind. Aber diese anderen Länder gehen uns wenig an, sagte Reger, nur unser Land geht uns etwas an und deshalb schlägt es uns tagtäglich auf den Kopf, daß wir mittlerweile schon lange tatsächlich ohnmächtig in einem Land zu existieren haben, in welchem die Regierung gemein und stumpfsinnig und verheuchelt und verlogen und dazu noch abgrundtief dumm ist. Jeden Tag empfinden wir doch, wenn wir denken, nichts anderes, als daß wir von einer verheuchelten und verlogenen und gemeinen Regierung regiert werden, die dazu auch noch die dümmste Regierung ist, die man sich vorstellen kann, sagte Reger, und wir denken, daß wir daran nichts ändern können, das ist ja das Fürchterliche, daß wir daran nichts ändern können, daß wir ohnmächtig zuschauen müssen, wie diese Regierung mit jedem Tag immer noch verlogener und verheuchelter und gemeiner und niedriger wird, daß wir mehr oder weniger in einem dauerhaft fassungslosen Zustand zuschauen müssen, wie diese Regierung immer schlimmer und unerträglicher wird. […] Tatsächlich ist dieses Land jetzt auf einem absoluten Tiefpunkt angelangt, sagte Reger, und bald hat es einen Sinn und Zweck und seinen Geist aufgegeben. Und überall dieses ekelerregende Demokratiegefasel! Sie gehen auf die Straße, meinte er, und müssen sich fortwährend Augen und Ohren und auch die Nase zuhalten, um in diesem Land, das letzten Endes ein ganz gemeingefährlicher Staat geworden ist, überleben zu können, saget Reger. Jeden Tag trauen sie ihren Ohren nicht, sagt er, jeden Tag erleben sie den Niedergang dieses zerstörten Landes und dieses korrupten Staates und dieses verdummten Volkes mit immer größerem Erschrecken. Und die Menschen in diesem Land und in diesem Staat tun nichts dagegen, sagte Reger, das ist es, das einen Menschen wie mich täglich peinigt. […] Die Politiker sind die Mörder, ja die Massenmörder eines jeden Landes und eines jeden Staates, sagte Reger, seit Jahrhunderten morden die Politiker die Länder und die Staaten und niemand hindert sie daran. Und wir Österreicher haben die gefinkeltsten, gleichzeitig gedankenlosesten Politiker als Landes- und Staatenmörder, sagte Reger. An der Spitze unseres Staates stehen Politiker als Staatenmörder, in unserem Parlament sitzen Politiker als Staatenmörder, sagt er, das ist die Wahrheit. Jeder Kanzler und jeder Minister ist ein Staatenmörder und damit auch ein Landesmörder, sagte Reger, und geht der Eine kommt der Andere, sagte Reger, geht der eine Mörder als Kanzler, kommt schon der andere Kanzler als Mörder, geht der eine Minister als Staatenmörder, kommt schon der andere. […] Die Politiker sind Staatenmörder und Landesmörder, sagte Reger, und sie morden, solange sie an der Macht sind, ungeniert und die Justiz im Staat unterstützt ihr gemeines und niederträchtiges Morden, ihren gemeinen und niederträchtigen Mißbrauch. Aber jedes Volk und jede Gesellschaft verdienen natürlich den Staat, den sie haben und sie verdienen also auch seine Mörder als Politiker, sagte Reger. Was für gemeine und stumpfsinnige Staatsmißbraucher und gemeine und perfide Demokratiemißbraucher rief er aus. […] Die politischen Verhältnisse in diesem Land sind im Augenblick so deprimierend, daß sie einem nurmehr noch schlaflose Nächte gestatten müßten […].“ (Bernhard, Thomas: Alte Meister, Suhrkamp, 1988, S. 212-216)
Frohe Weihnachten!
30.11.2017: Der Philosoph im Hauptquartier der ÖBB

Eingeladen vom Vorstand der ÖBB, um zum Thema ›Ich und Wir — Über die Natur des Miteinander‹ zu reden, bot sich mir die Gelegenheit, das fragile Verhältnis des Einzelnen zur Gemeinschaft philosophisch zu beleuchten. Die beiden diametralen philosophischen Positionen des Individualismus und des Kollektivismus bildeten dabei die theoretische Grundlage der Debatte. Dem Individualismus nach steht die Realisierung von Wünschen und Zielen, die Kultivierung von Anlagen und Fähigkeiten ebenso wie die Befriedigung von Bedürfnissen im Zentrum des individuellen Handelns, während der Gesellschaft, in der ein Individuum lebt, lediglich instrumenteller Wert zukommt, nämlich insofern, als sie ein Mittel ist, um das angestrebte, individuelle Wohlergehen zu realisieren. Zwar können wir ohne Gesellschaft unsere Individualität nicht verwirklichen, doch, so die Auffassung des Individualismus, besteht ihr Sinn nur darin, den Individuen ein möglichst gutes Leben zu ermöglichen. Dem Kollektivismus wiederum nach handeln die Individuen gerade nicht, um ihre individuellen Interessen zu verfolgen oder Bedürfnisse zu befriedigen, sondern um zum Gedeihen der Gesellschaft, in der sie leben und von der sie abhängen, beizutragen. Das Wohlergehen der Gesellschaft gilt hier als in sich selbst wertvoll, während das einzelne Individuum bloß Mittel zum Zweck ist, um dieses Wohlergehen zu realisieren. Man sieht leicht ein, dass es sich hierbei um zwei antagonistische »Bewegungen« handelt. Nichtsdestoweniger sind wir sowohl im Alltag als auch auf theoretischer Bühne damit konfrontiert und das Nachdenken darüber ist unumgänglich, wenn uns daran gelegen ist, die soziale Teil-Ganzes-Beziehung auf einer ganz allgemeinen Ebene zu verstehen und richtig zu deuten.
© Bild: Foto Marek
29.11.2017: Kolloquium ›Die Logik der Welt‹

Mit dem Kolloquium ›Die Logik der Welt‹, das vom 25-26.11.2017 am wunderschönen Grundlsee stattfand, endet das Akademiejahr 2017. Noch einmal sind wir, gemeinsam mit unseren Teilnehmerinnen und Teilnehmern, oder besser gesagt, den Freundinnen und Freunden der Academia Philosophia, in eine Welt eingetaucht, die von so ganz anderer Gestalt ist, deren Distanz zur Alltagsrealität kaum größer sein könnte, die aber nichtsdestoweniger faszinierend und schillernd ist. Die Flughöhe philosophischer Betrachtung ist immer hoch, manchmal schwindelerregend, aber stets wohltuend, wie wir glauben, denn die Philosophie befreit uns von der Tyrannei der Gewohnheit — um es mit den Worten Bertrand Russells zu sagen — und vergrößert damit “nicht nur die Gegenstände unseres Denkens, sondern auch die unseres Handelns und unserer Neigungen: sie macht uns zu Bürgern der Welt und nicht nur zu Bewohnern einer ummauerten Stadt, die mit der Welt vor ihren Toren im Kriege liegt. In dieser Weltbürgerschaft besteht die wahre Freiheit des Menschen, seine Befreiung aus der Knechtschaft kleinlicher Hoffnungen und Ängste”.
Die Logik der Welt — Eine Rückschau in Worten:
Von jeher sind die meisten Philosophinnen und Philosophen von dem Vorhaben besessen, die Welt vollständig zu erklären, mithin das Ganze der Welt, wie Schopenhauer sagt, abstrakt, allgemein und deutlich in Begriffen zu wiederholen und so als reflektiertes Abbild der Vernunft niederzulegen. Das mag einerseits an einer gnadenlosen und an Größenwahnsinn grenzenden Selbstüberschätzung liegen, andererseits an der Philosophie selbst; begreift sie sich doch als diejenige Disziplin, die den immer weiter fortschreitenden Erkenntnisprozess auf der höchsten Stufe der Allgemeinheit zu einem Abschluss zu bringen sucht. Ein Befund, dem die Protagonisten unseres Kolloquiums wohl zustimmen würden, jedenfalls heute, mit ein wenig Abstand zu ihren ehemals großen Taten: Parmenides, Platon, Aristoteles, Leibniz, Gödel und nicht zuletzt Hegel. Die Suche nach Wahrheit und die Hoffnung einer umfassenden Erhellung der epistemischen Situation, in der wir uns als erkennende Wesen befinden, wurde ihnen allen gleichermaßen zum Ausgangspunkt ihrer Arbeiten zu einer Logik der Welt.
Bei Parmenides hebt der Gedanke einer logischen Welt an. Die Tatsache, dass wir in der Lage sind, uns denkend auf die Welt zu beziehen, und dass das Denken darüber hinaus logischen Gesetzmäßigkeiten folgt, bewegt ihn einerseits zu der Auffassung, dass die Wahrnehmungswelt, mitsamt ihren Gegenständen, Ereignissen und Zusammenhängen in Raum und Zeit, und der damit einhergehenden steten Veränderung von allem überhaupt, eine bloße Scheinwelt ist, pure Illusion. Anderseits, dass die Welt realiter ein vollkommen statisches Gebilde sein muss, außerhalb von Raum und Zeit. Eine Welt ewiger Wahrheit, mithin eine logische Welt, eine Welt abstrakter Entitäten logischen Zuschnitts, wenn man so will. Sich denkend auf die Welt beziehen ist nämlich nur dann möglich, so Parmenides, wenn Denken und Welt isomorph sind, mithin strukturgleich. Diese Strukturgleichheit kann es aber nur zwischen den logischen Gesetzmäßigkeiten des Denkens und einer logischen Welt geben, keinesfalls aber einer empirischen.
Platon greift den Gedanken Parmenides auf. Auch bei ihm findet sich eine Zweiteilung der Welt. Doch anders als seinem Vorgänger ist ihm die Welt der Wahrnehmung nicht bloß Illusion, sondern vielmehr Abbild, Schatten. Aber Schatten wovon? Schatten der Ideen. Die Welt der Ideen, der allen Dingen zugrunde liegenden und sie ermöglichenden Ideale, der Blaupausen aller Dinge, wenn man so will, in welcher Gestalt und zu welcher Zeit sie auch immer auftreten mögen, ist für Platon die eigentliche Welt, während die Wahrnehmungswelt ihr Schatten ist. Es ist eine ewige, unveränderliche, unsterbliche und teillose Welt, die sich hier aufspannt, die sozusagen die obersten Strukturpläne der empirischen Realität als deren Realgrund beinhaltet, woraus folgt, dass es sich ganz und gar um eine abstrakte, immaterielle und in diesem Sinne logische Welt handeln muss.
Während Parmenides und Platon insofern eine Metaphysik der Logik vorlegen als sie zwischen der Wahrnehmungs- und der sie transzendierenden logischen Welt unterscheiden, findet sich bei Aristoteles eine Logik der Immanenz. Für ihn ist es nämlich unhintergehbar die empirisch zugängliche, in unserer Wahrnehmung vorliegende, Welt, die eine logische Welt ist. Doch auch hier findet sich der Isomorphiegedanke: Die logischen Gesetzmäßigkeiten unsers Denkens sind Projektionen der logisch-kategorialen Grundstruktur des Seienden, und so kommen wir von der logischen Analyse dieser Gesetzmäßigkeiten zum logischen Fundament der Welt.
Spätestens im Zusammenhang mit den Überlegungen Leibnizens wurde klar, was alle Denker — jedenfalls diejenigen vor ihm — implizit voraussetzen: Eine logische Welt ist notwendigerweise eine widerspruchsfreie Welt. Widerspruchsfreiheit ist das fundamentale Gütekriterium jedweder logischen Welt; ja des Logischen überhaupt, unabhängig davon, ob es sich um das Seiende oder das Gedachte handelt. Bei Leibniz umgrenzt nun die Widerspruchsfreiheit das logisch Mögliche und darüber hinaus auch das ontologisch Mögliche. Was widerspruchsfrei ist, das kann auch existieren. Widersprüchlichem hingegen ist die Möglichkeit der Existenz von vornherein genommen. Und so zeigt sich bei Leibniz, auf dem Prinzip des Widerspruchs aufruhend, eine fantastische Konzeption einer logischen Welt; oder besser gesagt: unendlicher vieler logischer Welten. Gott (er)denkt nämlich unendlich viele widerspruchsfreie, mithin logisch mögliche, und gerade deshalb verwirklichungsfähige Welten. Und eine unter diesen, nämlich die Beste, wird er am Ende des Tages im Schöpfungsakt tatsächlich verwirklichen. Somit ist die Welt, in der wir leben, denn diese und keine andere ist ja die verwirklichte, am Anfang, d. h. vor ihrer Schöpfung, eine durch und durch logische Welt, denn die Denkgebäude Gottes, mithin die im Voraus gedachten Welten, sind nichts anderes als begrifflich-abstrakte, nach logischen Gesetzmäßigkeiten aufgebaute, Konstruktionen.
Selbst der große Kurt Gödel hängt der Idee Leibniz’ nach. Mit einem einzigen Unterschied könnte man sagen: er eliminiert Gott. Das logisch Mögliche, mithin das Widerspruchsfreie existiert für Gödel nicht bloß in Form logisch möglicher Welten als Denkgebäude Gottes, sondern immer schon realiter. Was logisch möglich ist, besitzt nicht nur potenzielle Existenz, sondern aktuale. Das heißt: Jede nur denkbare möglich Welt existiert wirklich; sofern sie widerspruchsfrei ist.
Bei Hegel endlich könnte man, im schnellen hinschauen, den Eindruck gewinnen, dass er von der Logik wenig Ahnung hat, denn die Welt Hegels ist zwar eine logische Welt aber eine zutiefst widersprüchliche. Nicht zuletzt deshalb wird er von vielen Philosophinnen und Philosophen verachtungsvoll beiseitegelegt. Doch bei genauerer Hinsicht zeigt sich die Plausibilität dieses Gedankens, eröffnet sich einem eine fantastische Metaphysik der Logik von großer Tiefenschärfe und ungeheurer Tragweite: Logische Prinzipien sind für Hegel zunächst nicht nur Denkgesetze der Subjekte, der individuellen Geister, wenn man so will, sondern auch objektive Wesenheiten, die gleichsam das logische Gerippe der Welt, den sogenannten Weltgeist, konstituieren. Auch hier zeigt sich die Idee einer Isomorphie, und zwar im Sinne einer Strukturgleichheit von Weltgeist und Individualgeist. Auf eine andere Formel gebracht, muss man sagen: Die Welt ist ihrem Wesen nach Begriff; Weltgeist und Individualgeist insgesamt begrifflich-logischer Natur. Begriffe aber, so Hegel, sind insofern widersprüchlich, als sie stets ihr Gegenteil beinhalten. So beinhaltet etwa der Begriff der Unendlichkeit, den der Endlichkeit; der Begriff des Lebendigen, den des Todes; der Begriff des Seins, den des Nichts usw. usf. Doch diese Widersprüchlichkeit ist nicht eine bloß formale, sondern eine zutiefst reale; sowohl was den Weltgeist als auch den Individualgeist betrifft. Der Widerstreit der Begriffe im Weltgeist spielt sich nämlich auf der Bühne des Individualgeistes ab. Hier wird das Theater des ständigen Werdens und Vergehens, der Krieg zwischen Dasein und Nichtsein, aufgeführt, und zwar so lange, bis aller Widerspruch beendet, alles Fortschreiten von These über Antithese zu Synthese abgeschlossen, das begriffliche Fundament der Welt stabil und der Selbstentwicklungsprozess des Weltgeistes zum Stillstand gekommen ist.
Den Gesamttext ›Die Logik der Welt‹ finden Sie unter dem Menüpunkt Publikationen, und zwar der alphabetischen Reihenfolge nach sortiert.
20.11.2017: Studium extramurale der Philosophie

Soeben bin ich von meinem einwöchigen Aufenthalt an der Academia Philosophia in Wien zurückgekehrt, wo der zweite Abschnitt unseres Studiums extramurale zum Besten gegeben und der Jahrgang 2017 abgeschlossen wurde. Ausgehend von der Geschichte der Philosophie über die Logik, die Erkenntnistheorie und die Metaphysik führte uns der Weg des philosophischen Nachdenkens bis hin zur Ethik. Uns zu den höchsten Höhen der Abstraktion aufschwingend, eine angemessene theoretische Distanz wahrend, die Lebenspraxis ganz hinter uns lassend und damit alle Nutzengedanken zurückweisend, wurden uns Welt und Mensch von einem vollkommen anderen Standpunkt aus gewahr; zeigten sich uns die großen Schwierigkeiten, die uns als erkennenden, hoffenden und wollenden Wesen entgegentreten, wenn uns daran gelegen ist, die Welt, und uns selbst, als einen Teil davon, auf einem rationalen, logisch gesicherten Weg, zu verstehen. Es zeigten sich uns aber auch fantastische philosophische Denkgebäude, etwa die Erkenntnistheorie Immanuel Kants, der Idealismus George Berkeleys oder der Empirismus bzw. Skeptizismus David Humes, die allesamt dem Versuch geschuldet waren, eine theoretisch befriedigende Deutung von allem überhaupt vorzulegen.
23.10.2017: Vom Wert der Philosophie

Zum insgesamt vierten Mal seit Gründung der Academia Philosophia, deren Gründungsmitglied ich bin, hob am vergangenen Mittwoch das Studium extramurale der abendländischen Philosophie an. Ein Anlass, um über den Wert der Philosophie nachzudenken:
Häufig nämlich wird der Wert des philosophischen Denkens, mithin der Wert der Philosophie überhaupt, in Frage gestellt. Nicht zuletzt deshalb, weil viele Menschen unter dem Einfluss der Wissenschaft oder der Bedürfnisse des praktischen Lebens dazu neigen, in der Philosophie nicht mehr als ein harmloses, aber auch nutzloses Spiel zu sehen, das aus begrifflichen Haarspaltereien und Streitigkeiten über Dinge besteht, über die wir ohnehin nichts wissen können. Diese Auffassung ergibt sich offenbar teils aus einer falschen Vorstellung über Sinn und Zweck des Lebens, teils aus einer falschen Vorstellung über das, was die Philosophie erreichen will.
Die Naturwissenschaft ist – vermittels der mit ihrer Hilfe gemachten Erfindungen –unzähligen Menschen von Nutzen, die von ihr überhaupt keine Ahnung haben; deshalb darf man ihr Studium allemal empfehlen. Diese Art von Nützlichkeit ist nicht Sache der Philosophie. Wenn die Beschäftigung mit der Philosophie überhaupt einen Wert hat, dann kann dieser nur indirekt zustande kommen, durch den Einfluss auf das Leben derer, die sie sich mit ihr beschäftigen. In diesem Einfluss, in diesen Auswirkungen, müssen wir also zunächst den Wert der Philosophie suchen. Wir müssen uns außerdem – wenn wir bei diesem Versuch nicht scheitern wollen – von den Vorurteilen der fälschlich so genannten »Männer der Praxis« frei machen. Der »Praktiker« ist – einem häufigen Gebrauch des Wortes nach – jemand, der nur materielle Bedürfnisse kennt, der einsieht, dass der Mensch Nahrung für seinen Körper braucht, aber vergisst, dass auch der Geist seine Nahrung braucht. Wenn es allen Menschen gut ginge, wenn Armut und Krankheit auf das niedrigste überhaupt mögliche Maß reduziert wären, bliebe noch viel zu tun übrig, um eine Gesellschaft zu schaffen, die Wert hätte. Aber selbst in der Welt, die wir jetzt haben, sind die Güter des Geistes mindestens ebenso wichtig wie die leiblichen Güter. Der Wert der Philosophie ist ausschließlich unter den Gütern des Geistes zu finden; und nur Menschen, denen diese Güter nicht gleichgültig sind, können davon überzeugt werden, dass die Beschäftigung mit der Philosophie keine Zeitverschwendung ist.
Das Ziel der Philosophie – wie das aller anderen eigentlich geistigen Tätigkeiten, des Studiums im ursprünglichen Sinne des Wortes – ist Erkenntnis. Die Erkenntnis, um die es ihr geht, ist die Art von Erkenntnis, die Einheit und System in die angesammelten Wissenschaften bringt, und die Art, die sich aus einer kritischen Überprüfung der Gründe für unsere Überzeugungen, Vorurteile und Meinungen ergibt.
Es gibt viele Fragen und unter ihnen solche, die für unser geistiges Leben von profundem Interesse sind. Hat die Welt einen einheitlichen Plan oder Zweck, oder besteht sie aus einem zufälligen Zusammenspiel der Atome? Ist das Bewusstsein ein beständiger Teil der Welt, so dass wir noch auf ein unbeschränktes Wachstum hoffen dürfen, oder ist das Bewusstsein ein transistorisches Phänomen auf einem kleinen Planeten, auf dem das Leben nach einiger Zeit unmöglich werden wird? Haben Gut und Böse eine Bedeutung für die ganze Welt oder nur für uns Menschen? – Das sind Fragen, die die Philosophie stellt, und die von verschiedenen Philosophen verschieden beantwortet worden sind.
Man muss zugeben: Viele Philosophen haben gemeint, dass die Philosophie die Wahrheit bestimmter Antworten auf solche fundamentalen Fragen feststellen könne. Doch so gering die Hoffnung, Antworten zu finden, auch sein mag: es bleibt Sache der Philosophie, weiter an diesen Fragen zu arbeiten, uns ihre Bedeutung bewusst zu machen und alle möglichen Zugänge zu erproben. Der Wert der Philosophie darf nämlich nicht von irgendeinem fest umrissenen Wissensstand abhängen – im Gegenteil – ihr Wert besteht gerade wesentlich in der Ungewissheit, die sie mit sich bringt.
Wer niemals eine philosophische Anwandlung gehabt hat, der geht durchs Leben und ist wie in ein Gefängnis eingeschlossen: von den Vorurteilen des gesunden Menschenverstands, von den habituellen Meinungen seines Zeitalters oder seiner Nation und von den Ansichten, die ohne die Mitarbeit oder die Zustimmung der überlegenden Vernunft in ihm gewachsen sind. So ein Mensch neigt dazu, die Welt bestimmt, endlich, selbstverständlich zu finden; die vertrauten Gegenstände stellen keine Fragen, und die ihm unvertrauten Möglichkeiten weist er verachtungsvoll von der Hand. Sobald wir aber anfangen zu philosophieren führen selbst die alltäglichsten Dinge zu Fragen, die man nur sehr unvollständig beantworten kann. Die Philosophie kann uns zwar nicht mit Sicherheit sagen, wie die richtigen Antworten auf die gestellten Fragen heißen, aber sie kann uns viele Möglichkeiten zu bedenken geben, die unser Blickfeld erweitern und uns von der Tyrannei des Gewohnten befreien.
Ihren Wert – vielleicht ihren vornehmsten Wert – gewinnt die Philosophie durch die Größe der Gegenstände, die sie bedenkt, und durch die Befreiung von engen und persönlichen Zwecken, die sich aus dieser Betrachtung ergibt. Wer sich gleichsam von seinen Instinkten treiben lässt, der bleibt in dem engen Kreis seiner privaten Interessen eingeschlossen: Familie und Freunde mögen mit zu diesem Kreis gehören, aber die Außenwelt ist nur das, was die Vorgänge im Kreis der instinktiven Wünsche fördert oder stört. Diese Lebensform mutet irgendwie fiebrig und eingezwängt an, und das philosophische Leben ist im Vergleich dazu ruhig und frei.
Wenn wir es nicht fertig bringen, unserer Interessen zu erweitern, bis sie die ganze Außenwelt umfassen, sind wir in der gleichen Lage wie die Garnison einer belagerten Festung: wir wissen, dass der Feind uns nicht entkommen lassen wird und dass die Kapitulation letzten Endes unvermeidlich ist. Wenn wir so leben, wird es keinen Frieden sondern nur einen endlosen Streit zwischen dem Drängen unserer Begierden und der Machtlosigkeit unseres Willens geben. Und wenn unser Leben groß und frei sein soll, müssen wir diesem Streit und unserer Gefangenschaft in ihm entkommen.
Ein Ausweg ist die philosophische Kontemplation. Der Geist, der sich an die Freiheit und Unparteilichkeit derselben gewöhnt hat, wird sich auch in der Welt des Fühlens und Handelns etwas von dieser Freiheit und Unparteilichkeit erhalten. Er wird seine Ziele und Wünsche als Teile des Ganzen betrachten, und ihre Dringlichkeit wird sich vermindern, weil er sie als unendlich kleine Bruchteile einer Welt sieht, die im Ganzen von den Taten eines einzelnen Menschen unbeeinflusst bleibt. Die Unparteilichkeit, die in der Kontemplation das unvermischte Verlangen nach Wahrheit ist, ist dieselbe Qualität des Geistes, die sich im Handeln als Gerechtigkeit ausdrückt, und im Fühlen als jene umfassende Liebe, die allen gelten kann und nicht nur jenen, die man für nützlich oder für bewunderungswürdig hält. So vergrößert die Kontemplation nicht nur die Gegenstände unseres Denkens, sondern auch die unseres Handelns und unserer Neigungen: sie macht uns zu Bürgern der Welt und nicht nur zu Bewohnern einer ummauerten Stadt, die mit der Welt vor ihren Toren im Kriege liegt. In dieser Weltbürgerschaft besteht die wahre Freiheit des Menschen, seine Befreiung aus der Knechtschaft kleinlicher Hoffnungen und Ängste.
Fassen wir unsere Betrachtungen über den Wert der Philosophie zusammen: man soll sich mit der Philosophie nicht so sehr wegen irgendwelcher bestimmter Antworten beschäftigen – denn in der Regel kann man diese bestimmten Antworten nicht als wahr erkennen. Man soll sich um der Fragen selber willen mit ihr beschäftigen, weil sie unsere Vorstellungen von dem, was möglich ist, verbessern, unsere intellektuelle Phantasie bereichern und die dogmatische Sicherheit vermindern, die den Geist gegen alle Spekulation verschließt. Vor allem aber werden wir durch die Größe der Welt, die die Philosophie betrachtet, selber zu etwas Größerem gemacht und zu jener Einheit mit der Welt fähig, die das größte Gut ist, das man in ihr finden kann.
(Der hier vorgelegte Text ist eine Zusammenfassung der Gedanken Bertrand Russells, zum Wert der Philosophie, und ist, bis auf einige wenige Änderungen, vollständig zitiert nach: Russell, Bertrand: Probleme der Philosophie, Suhrkamp Verlag, 1967)
25.09.2017: Kolloquium ›Philosophischer Feminismus‹

Kolloquium ›Philosophischer Feminismus‹
Mit einem zweitägigen Kolloquium zum Philosophischen Feminismus hob am vergangenen Wochenende der philosophische Herbst der Academia Philosophia an. Eine Rückschau in Form eines Gedankensplitters:
In der gegenwärtigen, vor allem politisch geprägten, Feminismus-Debatte bleiben die tiefer liegenden Fragen, deren Aufwerfen in Bezug auf ihr theoretisches Fundament zwingend ist, nicht nur unbeantwortet, sondern sie werden zumeist noch nicht einmal gesehen. Fragen zur ontologischen Rolle der Sprache, zum Einfluss biologistischer Weltanschauung oder zur soziokulturellen Konstruktion der Geschlechterdifferenz. Im Kolloquium ›Philosophischer Feminismus‹ sind wir diesen Fragen mit der Trennschärfe philosophischer Analyse begegnet. Unter anderem in der Beschäftigung mit Luce Irigaray, Simone de Beauvoir und Judith Butler haben wir uns zunächst die Voraussetzung schlechthin einer jeden Feminismus-Debatte erarbeitet: die Zurückweisung eines, wie auch immer gearteten, Biologismus einerseits und der Vorstellung der Nicht-Kontingenz historischer wie soziokultureller Entwicklungen andererseits. Denn nur wer auf der einen Seite glaubhaft machen kann, dass die (vermeintliche) Geschlechterdifferenz und die Anlagen, die den Geschlechtern über ihre traditionellen Rollen zugeschrieben werden, nicht biologisch determiniert sind, und wer auf der anderen Seite zeigt, dass die Kulturgeschichte, in deren Gefolge sich Differenz und Rollenzuschreibung ausgebildet haben, eine zufällige ist, sich also auch ganz anders hätte zutragen können, erhält den intellektuellen Spielraum, die eine jede diesbezügliche Debatte verlangt. Im Anschluss daran, haben wir uns mit den beiden philosophischen Grundpositionen beschäftigt, auf die sich alle möglichen Positionen der Feminismus-Debatte zurückführen lassen: Differenzfeminismus und Gleichheitsfeminismus. Während die Kernthese des einen in der Behauptung besteht, dass die Geschlechter von Grund auf verschieden sind, und dass die Emanzipation der Frau vom Mann gerade nicht in einer Verflachung dieser Verschiedenheit bestehen kann, sondern in ihrer Verschärfung, lautet die Kernthese des anderen, dass es zwar de facto eine Verschiedenheit der Geschlechter gibt, diese Verschiedenheit aber bedeutungslos ist. Einen der radikalsten Ansätze vertritt in diesem Zusammenhang Judith Butler. Ihr zufolge ist die gesamte Feminismus-Debatte, ja vielmehr noch, die gesamte Feminismusbewegung, immer noch in der vom Patriarchat installierten binären Matrix der Differenzierung von Mann und Frau gefangen, was zur Folge hat, dass die Frauen zwar einen Geschlechterkampf führen, aber auf einer Bühne, die von Männern installiert wurde und die ihren Spielplan kontrollieren. Bleibt die feministische Bewegung hier stehen, wird sie scheitern. Es gilt daher die Grenzpfähle niederzureißen und die Geschlechter insgesamt aus der engen Umklammerung einer Zweiteilung der Welt in Weibliches und Männliches zu befreien, für die die Subjekte erbarmungslos »zerhackt« und das Reich möglicher Identitäten eliminiert werden. So zeigt sich aber auch, dass die Feminismus-Debatte, und zwar in ihrer philosophischen Dimension, nicht nur eine Debatte der Emanzipation der Frau gegenüber dem Mann ist, sondern insgesamt radikale Gesellschaftskritik, weshalb sie jeden angeht. Die Phallokratie nämlich, die das Patriarchat aufgerichtet hat, ist nichts anderes als eine Herrschaftsform, die die Frau zum Objekt macht und die allein schon deshalb verachtenswert ist.
Obschon die Philosophie, oder besser gesagt, die Philosophinnen und Philosophen prinzipiell dazu in der Lage sind, die Grundstrukturen gesellschaftlicher, und wie hier feministischer, Problemstellungen aufzudecken, die Hintergrundvoraussetzungen zu problematisieren und Theorien zu entwerfen, die es erlauben komplexe Sachverhalte in ihrer Tiefe zu verstehen, bleiben sie uns auch in diesem Fall eine Handlungsanleitung schuldig. Doch darin liegt gerade nicht das Moment ihrer Disqualifikation, sondern ihrer besonderen Schönheit. Es mag sein, dass der berühmte Karl Marx recht hat, wenn er sagt, dass die Philosophen die Welt stets nur unterschiedlich interpretiert haben, es aber darauf ankommt sie zu verändern, doch die Veränderung der Welt im Sinne einer praktischen Revolution auf den Straßen derselben, ist schlicht und ergreifend nicht ihr Geschäft. Vernünftigerweise! Theorie und Praxis sind nämlich ganz verschiedene Formen der Auseinandersetzung mit Welt und Mensch. Sie haben streng genommen nichts gemeinsam. Es fehlt nämlich ein logisch einwandfreier Übergang vom einen zum anderen. Mag die Theorie auch vollständig sein und uns einen Ausschnitt der Welt, oder die Welt insgesamt, bis ins letzte Detail verständlich machen, so bleibt jede Handlungsempfehlung, weil sie nicht mit der notwenigen Strenge aus ihr abgeleitet werden kann, nichtsdestoweniger zufällig und alles Tun in ihrem Gefolge ebenso. Das heißt nun freilich nicht, dass die Praxis für die Philosophie irrelevant wäre. Sie ist ja die Quelle vieler philosophischer Probleme, doch der Fortschritt in der Philosophie, so lautet dann auch der Befund Ansgar Beckermanns, besteht im Allgemeinen nicht in der Lösung, sondern in der Klärung derselben.
13.09.2017: Achilles und die Schildkröte

Achilles und die Schildkröte
Der Gedankensplitter kommt heute als philosophisches Gedankenexperiment daher. Es stammt von Zenon von Elea und will verdeutlichen, dass alle Bewegung, die wir wahrnehmen, Illusion ist. Der unbesiegbare Achilles nämlich wird das Wettrennen gegen die Schildkröte, der er auf einer Strecke von fünfhundert Metern länge einen Vorsprung von einhundert Metern gewährt, verlieren, weil es ihm unmöglich ist, sie zu überholen: Denn tatsächlich ist es ja notwendig, dass das Verfolgende — mithin Achilles —, bevor es überholt, zunächst einmal den Punkt erreicht, von dem aus das Einzuholende — mithin die Schildkröte — flieht. Während nun das Verfolgende diesen Punkt erreicht, wird das Fliehende eine gewisse Strecke vorwärtskommen, mag das auch weniger sein, als das Verfolgende vorankam. In dem Zeitraum wiederum, in dem das Verfolgende diese Strecke zurücklegt, die das Fliehende soeben vorwärtsgekommen ist, in diesem Zeitraum wird das Fliehende abermals ein gewisses Stück zurücklegen. Und so wird in jedem Zeitraum, in dem das Verfolgende die Strecke durchquert, die das Fliehende, das langsamer ist, soeben bereits durchquert hatte, das Fliehende erneut ein gewisses Stück vorankommen, mag es auch noch so klein sein. Woraus folgt, dass Achill die Schildkröte niemals überholen kann, weil er sie niemals einholen kann.
04.09.2017: Kolumne "Philosophisch gedacht"

Vom Ruf nach Praxis
Es ist äußerst bedauerlich, dass selbst die Philosophie vom Ruf nach Praxis, nach Anwendbarkeit, nach lebenspraktischer Nützlichkeit, nicht verschont bleibt. Ein Ruf, der möglicherweise dem Zeitgeist geschuldet ist – und der erstaunlicherweise von einigen Philosophinnen und Philosophen selbst kommt –, demnach nur dasjenige Wert hat, was nützlich ist. Fast reflexartig wird in diesem Zusammenhang auf die Antike verwiesen. In ihr, so wird diagnostiziert, hätte die Philosophie noch den Charakter einer Lebensschule besessen, während sie heute über weite Strecken zu sachlich, zu logisch, zu rational, zu lebensfern, ja insgesamt zu akademisch sei. Nun: Es ist unbestritten, dass sich einige Denker der Antike insofern der Lebenspraxis zuwandten, als sie die Frage zu beantworten suchten, wie zu Leben gut sei. Doch Lebenspraxis und das Nachdenken über selbige sind zwei Paar Schuhe. Während es in dem einen Fall um konkrete Handlungsvollzüge geht, geht es in dem anderen Fall um eine theoretische Beschäftigung mit dem Leben. Das sollte man nicht vergessen. Wenn also überhaupt, dann war die überwiegende Mehrheit der antiken Philosophen am Leben wohl nicht im Sinne einer Lebenspraxis interessiert, sondern im Sinne seines Verstehens derselben. Wie die gesamte Philosophie insgesamt ein Bemühen um Verständnis ist. Ich frage mich ganz grundsätzlich, woher dieser andauernde, penetrante und kaum noch auszuhaltende Ruf nach Praxis rührt, der einen von überall herkommend belästigt. Und warum kann es nicht wenigstens in der Philosophie genug sein, nur den Versuch zu unternehmen, die Welt und uns selbst als einen Teil davon denkend zu verstehen, mithin ein theoretisches, also logisch organisiertes, Gesamtbild des Wirklichen zu entwerfen? Warum zum Teufel soll auch noch die Philosophie therapieren, optimieren, heilen oder verändern müssen? Es gibt sicher gute Werkzeuge, um das je eigene Leben praktisch zu gestalten: Meditation, Yoga, Religion oder was sonst noch alles. Die Philosophie aber ist kein solches Werkzeug. Das wird jedem einleuchten, der sich ernsthaft mit ihr beschäftigt.
Autor: Bernd Waß
Bild: Pexels, Zero-Lizenz
Diskussionsbeiträge bitte an: b.wass@academia philosophia.com
24.08.2017: Buchneuerscheinung

Gottfried Wilhelm Leibniz — Grundriss eines philosophischen Meisterwerks
Mit dem Buch ›Gottfried Wilhelm Leibniz — Grundriss eines philosophischen Meisterwerks‹ lege ich eine knappe, aber durchaus tiefenscharfe, Einführung in das umfassende Denkgebäude des letzten Universalgelehrten Gottfried Wilhelm Leibniz vor. Die großen Bewegungen seiner Philosophie, insbesondere seiner Metaphysik, die Theorie der möglichen Welten, die Monadologie und die Theodizee, werden ebenso besprochen wie Leibnizens Freiheitsproblem und die Suche nach universeller Harmonie. Mann kann das Buch im Sinne einer Propädeutik lesen – als Vorbereitung zum Studium der Originaltexte –, als Verbindungsglied zu umfangreicheren Abhandlungen über Leibniz, aber auch als eine sich geschlossene Arbeit, deren Anspruch es ist, Leibnizens Denken systematisch nachzuzeichnen und seinen Versuch einer metaphysischen Weltdeutung im Prinzip verständlich zu machen.
›Gottfried Wilhelm Leibniz — Grundriss eines philosophischen Meisterwerks‹ ist als Paperback (978-3-7439-5183-9), Hardcover (978-3-7439-5184-6) und E-Book (978-3-7439-5185-3) erschienen.
04.08.2017: Denkgebiete der Philosophie / Teil 4

Denkgebiete der Philosophie, Teil 4: Metaphysik
„Unser Datum ist die wirkliche Welt, zu der wir selbst gehören; und diese wirkliche Welt bietet sich der Beobachtung in Gestalt des Inhalts unserer unmittelbaren Erfahrung dar.“ Metaphysik zielt nun darauf ab, „ein kohärentes, logisches und notwendiges System allgemeiner Ideen zu entwerfen, auf dessen Grundlage jedes Element unserer Erfahrung interpretiert werden kann.“ Das ist jedenfalls das Metaphysik-Verständnis von Alfred North Whitehead, das er in seinem Hauptwerk ›Prozeß und Realität‹ skizziert. Man kann Metaphysik aber auch im Sinne Peter van Inwagens begreifen. Für ihn ist die Metaphysik, „die Untersuchung der letzten Realität.“ Die letzte Realität ist das, was hinter allen Erscheinungen steht und alle Regresse von Erscheinungen und relativer Realität abschließt.“ Oder aber man fasst Metaphysik im Sinne Reinhard Kleinknechts auf: Metaphysik ist dann im Wesentlichen die Frage nach der Existenz und Beschaffenheit einer (wahrnehmungs-) transzendenten Wirklichkeit, die als Realgrund einer (wahrnehmungs-) immanenten Wirklichkeit in Erscheinung tritt. Hier geht es also um die Frage, ob sich die empirische Realität aus sich selbst heraus verstehen lässt, oder ob es hierfür transempirischer Entitäten bedarf. Und Uwe Meixners Metaphysik-Vorstellung endlich besagt, dass die Metaphysik diejenige menschliche Aktivität ist, „die darauf abzielt, auf einer hohen Stufe der begrifflichen Allgemeinheit ein theoretisches (also logisch organisiertes) Gesamtbild von allem überhaupt […] hervorzubringen“ und unser Wissen darüber, was überhaupt existiert, zu einem Abschluss zu bringen.
20.06.2017: Sommerakademie der Academia Philosophia

Soeben bin ich von der Sommerakademie der Academia Philosophia heimgekehrt, die zum zweiten Mal in Castelfranco di Sopra, Italien, stattgefunden hat. Eine fantastische, genussreiche und philosophisch äußerst lehrreiche Woche. Uns im Müßiggang übend vergegenwärtigten wir uns das philosophische Vermächtnis von Gottfried Wilhelm Leibniz und Theodor Wiesengrund Adorno. Zwei Denker aus ganz unterschiedlichen Zeiten und einem philosophischen Programm, das die Spannweite philosophischer Weltdeutung auf eine Weise offenbarte, wie es dramatischer hätte nicht sein können. Auf der einen Seite Leibniz, der mit seiner radikalen Überhöhung der Vernunft und der Annahme einer Isomorphie zwischen göttlichem und menschlichem Denken das Projekt einer vollständigen Erkenntnis der Welt vorantrieb; auf der anderen Seite Adorno, dessen umfassende Gesellschaftskritik mit einer scharfen Vernunftkritik anhob, die dem Denken faschistoide Züge zuschrieb und der Vernunft eine Mitschuld am Wahnsinn der Nazidiktatur attestierte.
09.05.2017: Die Denkgebiete der Philosophie / Teil 3

Denkgebiete der Philosophie, Teil 3: Erkenntnistheorie
Die Erkenntnistheorie als philosophische Disziplin ist eine systematische Untersuchung aller möglichen Erkenntnisarten, verbunden mit der Frage, welche der möglichen Erkenntnisarten uns in die Lage versetzt gesichertes Wissen über die Welt, und uns selbst als einem Teil davon, zu erlangen. Dabei geht es um alltägliche und wissenschaftliche Erkenntnis, um Erkenntnis einzelner Tatsachen und allgemeiner Gesetze, um Erkenntnis durch Erfahrung und durch Vernunft, um Erkenntnis der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft ebenso, wie um moralische, religiöse oder philosophische Erkenntnis. Darüber hinaus gilt es freilich zu klären, was Wissen überhaupt ist; also wovon genau die Rede ist, wenn wir behaupten, dass wir dieses oder jenes wissen. Im Alltag, aber auch in den meisten Wissenschaften, setzen wir ein intuitives Verständnis des Wissensbegriffs voraus, und wir tun dabei so, als würde dieser Begriff keinerlei Schwierigkeiten machen. Doch bei kritischer Betrachtung zeigt sich: Obschon sich unsere Gesellschaft als Wissensgesellschaft bezeichnet und Wissen zu einem ökonomisch wertvollen Gut geworden ist – um die Rechtfertigung unserer Wissensansprüche ist es aus philosophischer Sicht nicht allzu gut bestellt.
15.04.2017: Kolumne "Philosophisch gedacht"

Ganz abgesehen vom Seitenhieb auf die Philosophinnen und Philosophen: Selbst in der Philosophie wird sich die Kenntnis der deutschen Sprache in Bälde als obsolet erweisen. Vielerorts wird sie nämlich sukzessive, und ohne viel Aufhebens, durch die englische ersetzt. Die Gründe finden sich im Wahnsinn der Industrialisierung und der rücksichtslosen Ökonomisierung der Wissenschaften. Universitäten stehen im gnadenlosen Wettbewerb um die »besten Köpfe« und die größten Budgets und buhlen hemmungslos um die Gunst großer, internationaler Konzerne. Wer in diesem Industriezweig die erste Geige spielen will – was dem Anschein nach alle wollen – der muss international aufgestellt sein; der muss aber vor allem markttauglich sein und am Markt spricht man – warum auch immer – Englisch. Doch die schleichende Abschaffung der deutschen Sprache an deutschsprachigen Philosophieinstituten ist hinterhältiger Mord: Sie tötet nämlich die deutschsprachige Philosophie.
Man begeht einen schweren Fehler, wenn man glaubt, es wäre einerlei, ob in deutscher, englischer oder sonst irgendeiner Sprache geschrieben wird. Denken und Sprache bilden nämlich weithin eine Einheit. Eine Sprache ist niemals nur ein Instrument zur Artikulation von Gedanken, sondern Denken vollzieht sich unhintergehbar in einer Sprache. Und in keiner anderen Sprache kennen wir uns so gut aus, wie in der eigenen. In ihr organisieren wir nicht nur die Außenwelt, die uns gegenübersteht, sondern auch unsere Innenwelt. In ihr liegt nicht nur der Entwurf unserer Charaktere, sondern auch das Vermögen, uns im Leben zu orientieren. Von Kindesbeinen an beziehen wir auf diese Weise Stellung, nehmen Bezug auf Welt und Mensch. Ausnahmen mögen vielleicht jene sein, die zwei- oder mehrsprachig aufwachsen, doch selbst unter diesen scheint es Präferenzen zu geben: eine Bevorzugung der einen gegenüber einer anderen Sprache. Philosophie und philosophische Weltdeutung, mithin der Versuch die Welt denkend zu verstehen, sind radikal an Sprache gebunden. Wer die deutsche Sprache als Philosophensprache eliminiert, der eliminiert daher nicht nur ein beliebig austauschbares Instrument der Artikulation, sondern die Einzigartigkeit eines Denkens, eines bestimmten, eng umrissenen philosophischen Blicks auf Welt und Mensch, den es nur in dieser Sprache gibt. Denn in jeder anderen Sprache ist das Denken qua Sprache ein anderes, der Blick von diesem Blick verschieden. Obschon Ludwig Wittgenstein in seiner logisch-philosophischen Abhandlung etwas anderes meinte, erlaube ich mir dennoch, die Bedeutung seiner Worte auszuleihen, um das gesagte zuzuspitzen: Die Grenzen meiner Sprache sind die Grenzen meiner philosophischen Welt. Und diese Grenzen sind unaufhebbar. Die Philosophie der einen Sprache ist notwendig verschieden von der Philosophie der anderen. Sie lässt sich darin nicht wiederholen.
Einem weiteren Irrtum unterliegt, wer glaubt, man könnte Sprachen ohne Weiteres in andere Sprachen überführen. Das mag dort der Fall sein, wo es lediglich darum geht, einen groben Bedeutungszusammenhang zu vermitteln. Doch im Fall feingliedriger, hochabstrakter philosophischer Denkgebäude, die von jedem einzelnen Ausdruck und zugleich von ihrer Gesamtheit getragen werden, und wo selbst das vermeintlich Unbedeutende eine tragende Rolle spielt, ist das unmöglich. Übersetzungsakte verändern das Gebäude irreversibel, selbst dann, wenn der Übersetzter das zu Übersetzende selbst hervorgebracht hat. Wie hat es der große österreichische Schriftsteller Thomas Bernhard ausgedrückt: Ein übersetztes Buch ist wie eine Leiche, die bis zur Unkenntlichkeit verstümmelt worden ist.
Es gibt keinen Ausweg: Wer der deutschen Philosophie die Sprache nimmt, bringt sie um. Das mag für den Fortgang der Wissenschaften belanglos sein. Man muss sich aber in aller Deutlichkeit vor Augen führen, dass dieser besondere Blick, der unumgänglich an diese Sprache gebunden ist, verloren geht.
Autor: Bernd Waß
Bild: Die Zeit, Nr. 13/2017
Diskussionsbeiträge bitte an: b.wass@academia philosophia.com
25.03.2017: Die Denkgebiete der Philosophie / Teil 2

Denkgebiete der Philosophie, Teil 2: Logik
„Uns allen ist geläufig, dass man gehen, sprechen, essen und Fußball spielen lernen muss, warum also ausgerechnet das Denken nicht?“ (Franz Von Kutschera) Es besteht kein Zweifel: wir alle Denken, zumindest zeitweise. Doch die Tatsache, dass wir das tun, sagt freilich noch nichts darüber aus, dass wir es auch richtig tun. Das richtige Denken ist eine ganz andere Angelegenheit als das herkömmliche. Wer am richtigen Denken interessiert ist, der ist in der Logik gut aufgehoben. Die Logik ist nämlich, vereinfacht gesagt, die Lehre vom folgerichtigen Denken. Ihr Gegenstandsbereich ist aber, entgegen vielleicht der ersten Vermutung, nicht das Denken als solches, sondern die Sprache. Die Sprache ist nämlich nicht nur ein Mittel zum Ausdruck oder zur Mitteilung von Denkinhalten, sondern Denken und Sprache bilden weithin eine Einheit. Das hat besonders Wilhelm von Humboldt nachdrücklich betont. Bestimmte Denkfiguren und bestimmte sprachliche Gebilde lassen sich daher identifizieren. Ein wesentlicher Bestandteil sprachlicher Gebilde sind Sätze. Sätze wiederum haben bestimmte Merkmale, weisen bestimmte »Bauteile« auf und stehen in bestimmten Beziehungen zueinander. Die Untersuchung dieser Merkmale, »Bauteile« und Beziehungen, ist die eine Aufgabe der Logik. Die andere Aufgabe ist es, Werkzeuge bereitzustellen, die es erlauben unsere Denkakte auf ihre Güte hin zu überprüfen und logische gültige von logisch ungültigen Schlüssen zu unterscheiden.
19.03.2017: Programm der Academia Philosophia

Vor über fünf Jahren habe ich gemeinsam mit meinem Freund und Kollegen Heinz Palasser, die Academia Philosophia gegründet. Als private Akademie für Philosophie und philosophische Weltdeutung verstehen wir uns als Bindeglied zwischen den Elfenbeintürmen der akademischen Philosophie einerseits und einer breiteren Hörerschaft andererseits. Es wäre schade, so dachten wir uns, wenn die Faszination philosophischer Weltdeutung nur jenem kleinen Kreis von Menschen vorbehalten bliebe, der sich von Berufswegen mit der Philosophie beschäftigt.
In unserem philosophischen Programm 2017/2018 haben wir erneut Themen aufgegriffen, die uns schon lange interessieren, bisher aber noch einer Betrachtung harrten. Etwa der ›Philosophische Feminismus‹, die ›Logik der Welt‹, das Problem der ›Personalen Identität‹, der berühmte ›Wiener Kreis‹ oder die ›Philosophie des Alters‹.
27.02.2017: Kolloquium ›Realismus und Idealismus‹

Gemeinsam mit meinem Freund und Kollegen, dem Philosophen Heinz Palasser, ging am vergangenen Wochenende das Auftakt-Kolloquium 2017 der Academia Philosophia über die Bühne. Was ist die Welt und wie ist sie uns gegeben? Dieser Frage sind wir nachgegangen und mussten die Alltagsauffassung so wie die Auffassung der Einzelwissenschaften in aller Schärfe überwinden, um zu konsistenten Antworten zu gelangen. Im Alltag und in den meisten Einzelwissenschaften gibt es nämlich kein Problem. Die Wahrnehmungswirklichkeit ist eine objektive, mithin von uns und unserem Wahrnehmen unabhängige, Realität. Sie ist uns immer schon das Ganze des Wirklichen. Doch diese auf einem naiven Realismus gründende Auffassung ist unhaltbar. Das Wahrnehmungsgegebene ist nicht das objektive Reale. Daraus ergibt sich ein gewaltiges philosophisches Problem: Man muss sich entweder auf den Standpunkt eines Idealismus stellen oder den Versuch unternehmen einen Realismus zu begründen, der nicht auf Erkenntnis durch die Unmittelbarkeit der Wahrnehmung angewiesen ist. Im ersten Fall heißt dies, die Welt vollständig als ein Bewusstseinsgebilde zu deuten, im zweiten Fall einsichtig zu machen, wie sich das objektiv Reale auf metaphysischem Boden gründen lässt.
Wer in philosophischen Angelegenheiten unterwegs ist, der bewegt sich stets auf schwankendem Grund und zumeist in schwindelerregenden Höhen der Abstraktion. Im Kolloquium ›Realismus und Idealismus‹ haben wir es aber ohne Zweifel auf die Spitze getrieben. Herrlich!
22.02.2017: Studenten

Ein kleiner Seitenhieb.
20.02.2017: Die Denkgebiete der Philosophie / Teil 1

Die Denkgebiete der Philosophie, Teil 1: Geschichte der Philosophie
Warum sollte man sich überhaupt mit der Geschichte der Philosophie auseinandersetzen, könnte man Fragen, sind doch nicht wenige der Auffassung, dass die Ergebnisse des Nachdenkens vergangener Zeiten, ob des wissenschaftlichen Fortschritts zum größten Teil überholt, antiquiert oder schlichtweg falsch sind. Eine durchaus berechtigte Frage. Ich würde sagen: Das wertvolle Moment, dass der Beschäftigung mit der Geschichte im Allgemeinen und mit der Philosophiegeschichte im Besonderen innewohnt, liegt in ihrer Erklärungskraft. Der Staus quo des philosophischen Denkens wird über weite Strecken nur dann verständlich, wenn man sich die Genese dieses Denkens vor Augen führt. Insofern halte ich die Beschäftigung mit der Geschichte der Philosophie für eine in der Tat lohnende Angelegenheit. Doch womit haben wir es eigentlich zu tun? Die Philosophiegeschichte, wie sie uns heute in zahlreichen Werken vorliegt, ist die Gesamtheit der philosophischen Deutungs- und Erklärungsversuche von Mensch und Welt. Von jeher ist sich der Mensch selbst ein Rätsel und seine Stellung im Weltganzen ist ihm unklar. Aus dieser Rätselhaftigkeit und Unklarheit resultieren dann auch die großen Fragen, die wir uns immer wieder von Neuem vorzulegen haben: Wer sind wir? Woher kommen wir? Was ist unsere Rolle im Universum, Welchen Sinn können wir unserem Leben geben? Was ist der Sinn von Geschichte und Welt? usw. usf. Zu unterschiedlichen Zeiten wurden von den Philosophinnen und Philosophen unterschiedliche Antworten gegeben. Die Zusammenschau dieser Antworten heißt Geschichte der Philosophie.
06.02.2017: Emil M. Cioran

E. M. Cioran
“Man kann nicht nachdenken und bescheiden sein. Sobald der Geist sich in Bewegung setzt, nimmt er den Platz Gottes und alles sonstigen ein. Er ist Indiskretion, Übergriff, Profanierung. Er arbeitet nicht, er zersetzt. Die Spannung, die sein Vorgehen verrät, beweist Brutalität und Unerbittlichkeit. Ohne eine kräftige Dosis Grausamkeit könnte man keinen einzigen Gedanken zu Ende führen.” (E. M. Cioran: Vom Nachteil geboren zu sein, Suhrkamp, 2015)
14.12.2016: Kolumne "Philosophisch gedacht"

Philosophische Gedanken zum späten Jahr
Inspiriert von Blaise Pascal, Gottfried Wilhelm Leibniz und Friedrich Nietzsche
Früh brechen die Nächte an in dieser Zeit. Das Jahr neigt sich dem Ende zu. Ob zum letzten Mal? Wer weiß das schon. Und inmitten des Getriebes, des Wahnsinns der Besinnlichkeit, halten wir Ausschau. Stille. Ein Riss zwischen Tageslicht und Dunkel. Da hört man sie schreien: Geschäfte schreien, wir retten dich; Karrieren schreien, wir retten dich; Politiker schreien, wir retten dich; Religionen schreien, wir retten dich; Wissenschaften schreien, wir retten dich; Familien schreien, wir retten dich; Freunde schreien, wir retten dich. Die ganze Welt Geschrei.
Fensterlos möchte man sein; für einen Augenblick abgeschnitten von aller Erfahrung. Nichts mehr hören, nichts mehr sehen, nichts mehr fühlen. Ein metaphysischer Punkt unter metaphysischen Punkten. Jetzt, sich selbst vor Augen gestellt, ein Kaleidoskop des Zweifels: „Ich weiß nicht, wer mich in die Welt gesetzt hat, noch was die Welt ist, noch was ich selber bin; ich bin in einer furchtbaren Unwissenheit über alle Dinge; ich weiß nicht, was mein Leben ist, was meine Sinne sind, was meine Seele ist, ja selbst jener Teil von mir, der das denkt, was ich sage, der über alles und über sich selbst nachdenkt und sich nicht besser erkennt als das Übrige. Ich sehe diese furchtbaren Räume des Weltalls, die mich umschließen, und ich finde mich an einem Winkel dieser unermeßlichen Ausdehnung gebunden, ohne zu wissen, warum ich gerade an diesen Ort gestellt bin und nicht an einen anderen, noch warum mir die kleine Zeitspanne, die mir zum Leben gegeben ist, gerade an diesem und nicht an einem anderen Punkt der ganzen Ewigkeit zugeordnet ist: der Ewigkeit, die mir voraufgegangen ist, und jener, die mir folgt. Ich sehe auf allen Seiten nur Unendlichkeiten, die mich umschließen wie ein Atom und wie einen Schatten, der nur einen Augenblick dauert und nicht wiederkehrt. Alles, was ich weiß, ist, daß ich bald sterben muß, aber was ich am allerwenigsten kenne, ist dieser Tod selbst, dem ich nicht entgehen kann. Wie ich nicht weiß, woher ich komme, so weiß ich auch nicht, wohin ich gehe; und ich weiß nur, daß ich beim Verlassen dieser Welt für immer entweder in das Nichts oder in die Hand eines erzürnten Gottes falle, ohne zu wissen, welche von diesen beiden Bedingungen für ewig mein Los sein muß“ (Pascal, Blaise: Fragment 194).
Doch während die Paukenschläge des Lebens, die Welt der Einsichten in Trümmer legen, steigt Gelassenheit auf. Ihr Zusammenklang ist verräterisch; gibt Kunde vom großen Prinzip hinter allen Erscheinungen: Harmonie. Einheit in der Vielheit, Ordnung in der Unordnung, Schönheit in der Hässlichkeit. Und eben hier hebt sie an. So wie eine Melodie, die nur aus harmonischen Intervallen und Akkorden besteht, gar nicht als harmonisch empfunden werden kann, und wie wir das Licht erst durch die Schatten zu erkennen vermögen, so bedarf es auch im Leben der Dissonanzen, der Schatten. Sie nämlich tragen den Imperativ der Herrlichkeit: ihre unablässige Forderung nach Auflösung. Indem wir also im Denken und Handeln danach trachten, das Schwere mit dem Leichten, das Bittere mit dem Süßen, das Enge mit dem Weiten, die Verzweiflung mit der Hoffnung, die Angst mit dem Mut, die Traurigkeit mit der Freude, den Hass mit der Liebe, das Tiefste mit dem Höchsten, in sorgfältiger Abstimmung zusammenzuführen, entsteht das Meisterwerk unseres Lebens.
Früh brechen die Nächte an in dieser Zeit. Stille. Ein Riss zwischen Tageslicht und Dunkel. Jetzt hören wir ihn, den Klang unserer ruhmreichen Komposition, der das Geschrei der Welt verstummen lässt. Ein Augenblick. Doch „alle Lust will Ewigkeit, will tiefe, tiefe Ewigkeit“ (Nietzsche, Friedrich: Zarathustra).
Autor: Bernd Waß
Diskussionsbeiträge bitte an: b.wass@academia philosophia.com
29.11.2016: Kolumne "Philosophisch gedacht"

Von Idioten und Wahnsinnigen
Verfolgt man die weltweiten politischen Entwicklungen, den politischen Diskurs der letzten Monate, vielleicht der letzten Jahre, ebenso wie die Auffassungen derer, die wir heute zu den politischen Gewinnern zählen müssen, so drängt sich einem der Verdacht auf, dass hier etwas nicht stimmt, dass wir es womöglich mit Idioten und Wahnsinnigen zu tun haben, die sich — zumeist auf demokratische Weise gewählt — anschicken, über unsere Zukunft zu bestimmen. Gleich vorweg: Der Philosoph würde sich ohne Zweifel eines höflicheren Tones befleißigen, sich den Abstieg in die Niederungen dieser drastischen Wortwahl ersparen, wenn er nur könnte. Leider aber kann er nicht, was schlichtweg einer überaus trefflichen Analyse geschuldet ist, die der Philosoph und Vordenker der Aufklärung John Locke, in seinem Versuch über den menschlichen Verstand, durchführt:
„Die Gebrechen der Idioten scheinen auf mangelnder Geschwindigkeit, Aktivität und Beweglichkeit der intellektuellen Fähigkeiten zu beruhen, wodurch sie des Vernunftgebrauchs beraubt sind, während die Wahnsinnigen auf der anderen Seite unter dem entgegengesetzten Extrem zu leiden scheinen. Denn, wie mir scheint, haben sie nicht die Fähigkeit des Schließens eingebüßt, sondern verbinden nur gewisse Ideen in ganz verkehrter Weise und halten sie fälschlich für Wahrheiten. Sie irren also wie Menschen, die aus falschen Prinzipien richtige Schlüsse ziehen; denn durch eine übermächtige Einbildungskraft sehen sie ihre Einbildungen für Realitäten an und leiten richtige Schlüsse daraus ab. So kann man beobachten, daß ein Geisteskranker, der sich für einen König hält, einem richtigen Schluß entsprechend, die einem solchen gebührende Bedienung und Ehrerbietung und den entsprechenden Gehorsam verlangt. […] Es gibt freilich verschiedene Abstufungen des Wahnsinns ebenso wie des Schwachsinns; das wirre Durcheinanderwerfen von Ideen findet sich bei manchen […] in höherem, bei anderen in geringerem Grade. Kurz gesagt liegt wohl der Unterschied zwischen Idioten und Wahnsinnigen darin, daß die letzteren falsche Ideen verbinden und auf diese Weise falsche Sätze bilden, aber von diesen ausgehend richtig folgern und schließen, während die Idioten sehr wenige oder gar keine Sätze bilden und fast überhaupt keine Schlüsse ziehen“ (Locke, John: Versuch über den menschlichen Verstand, Meiner, S. 182).
Man ist immer noch einigermaßen verwundert, warum sie es nichtsdestoweniger vielerorts bis in die höchsten Ämter der Regierungen und an die Spitzen der Staaten schaffen. Doch bei genauerer Hinsicht scheint klar: Ohne uns der Fähigkeit des prüfenden, zergliedernden, an logischen Gesetzmäßigkeiten orientierten, tiefenscharfen Denkens zu bemächtigen, ist weder der Idiotie noch dem Wahnsinn beizukommen. Wir müssen Denken lernen! — Um jenen entgegentreten zu können, die die Errungenschaften der europäischen Aufklärung zerstören wollen, die bizarre Vorstellungen von Freiheit, Rechtsstaatlichkeit und Sicherheit hervorbringen und die die Menschenrechte mit Füßen treten.
Autor: Bernd Waß
Diskussionsbeiträge bitte an: b.wass@academia philosophia.com
17.11.2016: Kolumne "Philosophisch gedacht"

Von den Gegenständen diesseits und jenseits der Wahrnehmung
Es mag schon sein, dass es eine Welt gibt, die unserer Wahrnehmung prinzipiell unzugänglich ist, die mithin jenseits aller Wahrnehmung liegt, doch über eine solche Welt lässt sich nichts vernünftiges sagen. Mit anderen Worten: Metaphysik, also jene philosophische Disziplin, um deren Gegenstand es sich hierbei handelt, ist bloße Spekulation. Das ist eine weit verbreitete Auffassung, die heute vor allem in den Naturwissenschaften programmatisch ist, aber auch in der Philosophie immer wieder vertreten wurde. Man denke etwa an David Humes Klassifikation sinnvoller Sätze in empirische und tautologische, an Friedrich Nietzsches Abneigung gegen jeden Hinterwelt-Platonismus oder an den berühmten Wiener Kreis, dessen zentralem Anliegen zufolge sich philosophische Aussagen entweder auf Beobachtungssätze zu beziehen haben oder auf solche Sätze, die sich logisch auf Beobachtungssätze zurückführen lassen. Aufgrund der gewaltigen naturwissenschaftlichen Fortschritte der letzten einhundert Jahre, der damit einhergehenden Ausbildung eines durch und durch physikalistischen Weltbildes, sowie einer thematischen Annäherung der Philosophie an Physik und Neurobiologie, herrscht heute neuerlich die Tendenz vor, Fragestellungen mit Bezug auf wahrnehmungsjenseitige, metaphysische Gegenstände als Ausdruck einer unwissenschaftlichen, vernunftlosen Sicht der Dinge zu verstehen. Doch die Frage, worüber sich vernünftig reden lässt und worüber man, um es in Anlehnung an Wittgenstein zu sagen, besser schweigt, steht nicht nur im Mittelpunkt philosophisch-wissenschaftlicher Debatten, sondern erhitzt die Gemüter auch im Alltagsdiskurs. Der Grund für diese — da wie dort teils heftig geführten — Auseinandersetzungen ist leicht auszumachen, geht es doch letztlich um nichts Geringeres als darum, die Vorherrschaft in Erkenntnisfragen auszufechten; klar zu machen, wem die Deutungshoheit über die prinzipiellen Zusammenhänge im Universum zukommt. Dabei sind die empirischen Wissenschaften in einem überwältigenden Vorteil. Sie zeichnen ein immer genaueres Bild der Welt, das über weite Strecken in sich schlüssig ist, das mathematischen Anforderungen genügt und das im Einklang mit den Naturgesetzen steht. Vorstellungen über Gegenstände wie Gott oder Seele, platonische Ideen, teleologische Ursachen, morphogenetische Felder, Engel, Dämonen usw. können hier bei weitem nicht mithalten. Nicht zuletzt deshalb ist eine eigenartige »Verheiratung« der Empirie mit der Vernunft zu beobachten: Wer seine Auffassungen über die Architektur der Welt auf Beobachtbares stützt, der gilt als vernünftig; wer selbige hingegen auf Nicht-beobachtbares, also Wahrnehmungsjenseitiges stützt, der gilt als unvernünftig. Mit anderen Worten: Ein naturwissenschaftlich fundiertes Weltbild ruht auf guten Gründen, ein metaphysisches tut das nicht. Die Zeiten, in denen sich z. B. Werner Heisenberg zu sagen traute, dass die kleinsten Einheiten der Materie nicht physikalische Objekte im herkömmlichen Sinn des Wortes sind, sondern Formen, Strukturen oder, im Sinne Platons, Ideen, sind wohl vorbei. Die Gründe dieser aktuellen Geringschätzung metaphysischer Weltdeutung sind vielfältig. Erstens scheint eine angemessene Vorstellung von Zweck und Ziel der Beschäftigung mit dem Metaphysischen abhandengekommen zu sein. Jedenfalls in der Philosophie geht es hierbei um die Erforschung letzter Realität, um ein Gesamtbild von allem überhaupt, um einen definitiv letzen Abschluss unseres Wissens über die Welt. Der Ausdruck ‘letzte Realität’ verweist dabei auf den Gegensatz von Erscheinung und Realität, von einer Welt diesseits der Wahrnehmung und einer solchen jenseits derselben, und der damit einhergehenden Möglichkeit eines ständigen Rückgriffs auf immer neue Realitäten. Das Gesuchte — die letzte Realität —, wäre das, was hinter allen Wahrnehmungserscheinungen steht und alle Rückgriffe auf relative Realitäten zu einem Abschluss bringt. Zweitens wird — vor allem außerhalb der Philosophie — mit vollkommen untauglichen Mitteln an die Sache der Metaphysik herangegangen. Das hat zur Folge, dass die angebotenen Gedankengebäude, den rationalistischen Anforderungen, die an sie gestellt werden, das sind logische Perfektion und Kohärenz, nicht einmal im Ansatz genügen. Und endlich drittens sind die Gegenstände, die im Rahmen metaphysischer Arbeit noch immer verhandelt werden, man könnte sagen, veraltet. Dass Gott, Seele und ähnliche Gegenstände, ob der erdrückenden Last empirischer Befunde, wenig Aussicht auf Rehabilitation haben, ist einigermaßen einleuchtend.
Wenn es aber tatsächlich so ist, dass ein vernünftiges Weltbild ausschließlich solche Gegenstände und Zusammenhänge enthalten darf, die der sinnlichen Wahrnehmung zugänglich sind — die also diesseits und nicht jenseits des Wahrnehmbaren liegen —, dann muss es gelingen, den Einheitszusammenhang der Wahrnehmungswirklichkeit ohne Rückgriff auf eine transempirische Realität zu erklären. Doch das dürfte schwierig werden. Man kann nämlich von hier aus weder eine Welt objektiver Gegenstände begreiflich machen, noch die Vorstellung einer unbegrenzten Zeit oder der Existenz von Erlebniszusammenhängen, die nicht die eigenen sind. Man müsste — wie wir noch sehen werden — weitreichende Voraussetzungen akzeptieren, die selbst höchst problematisch sind. Andererseits ist einleuchtend, dass wahrnehmungsjenseitige Gegenstände, wie Gott und dergleichen mehr, den Anforderungen einer modernen Theorie der Welt nicht genügen, um es vorsichtig auszudrücken. Viel zu schwerwiegend wären die Probleme, in die man geriete, zöge man sie allen Ernstes als Erklärungsgrundlage in Betracht. Ein Dilemma. Erklärungen mit ausschließlicher Bezugnahme auf Gegenstände diesseits der Wahrnehmung erlauben es uns nicht, den Einheitszusammenhang der Wahrnehmungswirklichkeit lückenlos verständlich zu machen; und Erklärungen, die auf Realitäten jenseits der Wahrnehmung zurückgreifen gelten gemeinhin nicht als Ergebnis vernünftiger Überlegungen. Um dieses Dilemma aufzulösen, muss man den epistemischen Standpunkt ändern, von dem aus man der Welt begegnet. Erst dann wird man sehen, dass die Bezugnahme auf Gegenstände und Zusammenhänge jenseits der Wahrnehmung keinesfalls jenseits des Vernünftigen zu liegen kommt. Im Gegenteil: Unvernünftig ist, wie sich dann zeigt, wer dogmatisch daran festhält, das Weltganze ohne Bezug auf eine Wirklichkeit erklären zu wollen, die der Wahrnehmung unzugänglich ist. Vorausgesetzt freilich man hält sich an die Gütekriterien einer jeden Metaphysik: logische Perfektion und Kohärenz. Ich werde nun versuchen, einen solchen Standpunkt herauszuarbeiten, sozusagen eine Miniatur-Metaphysik vorzulegen, die es erlaubt den engen Horizont des Wahrgenommenen auf vernünftige Weise zu übersteigen.
Vergegenwärtigen wir uns zunächst den epistemischen Standpunkt, von dem aus wir der Welt üblicherweise begegnen und von dem aus sich uns die herkömmlichen metaphysischen, sprich wahrnehmungsjenseitigen Gegenstände, wie von selbst ergeben: Im Alltag, aber auch in den Wissenschaften, sind Wahrnehmungsinhalt und Welt ein und dasselbe. Häuser, Bäume, Hunde oder andere Menschen; Gehirne, Teilchenbeschleuniger oder Milchstraße — wir halten die Wahrnehmungsgegenstände, in all ihren Variationen, schlichtweg für Gegenstände einer Körperwelt, wie sie von der Physik beschrieben wird und worauf wir uns beziehen, wenn wir z. B. miteinander reden. Insofern finden sich diesseits der Wahrnehmung alle Gegenstände des täglichen Lebens ebenso wie alle Gegenstände der Wissenschaft. Jenseits der Wahrnehmung folglich alle anderen Gegenstände: Gott, Seele, platonische Ideen usw. Das ist die natürliche Weltansicht. Eine Gebilde des gewöhnlichen Lebens. Was der Wahrnehmungswirklichkeit zugeordnet werden kann, gilt als unbestreitbar. Zweifelt jemand an der Existenz irgendeines Dings, so müssen wir ihn nur hinführen, damit er es sehen, betasten, hören oder riechen kann, dann zweifelt er nicht mehr. Als höchst strittig hingegen gilt, was der Wahrnehmungswelt nicht zugeordnet werden kann.
Und doch ist die natürliche Weltansicht unzulänglich, lückenhaft und widerspruchsvoll. Das zeigt sich, sobald man die einfachen, selbstverständlichen Unterscheidungen des gewöhnlichen Lebens einer Begriffsanalyse unterzieht und sie sich in allgemeiner Form verständlich machen will: Die Gegenstände der Körperwelt, von der oben die Rede war, sind allgemeine Objekte und werden dementsprechend als objektiv charakterisiert. Sie werden als ein und dasselbe, als ein Identisches in allen Wahrnehmungen auch verschiedener Personen gedacht; als etwas, das eine stete, normale Bestimmtheit hat, auf die man bei Wahrnehmungsdifferenzen und im Streit über die richtige Auffassung verweisen kann. Darüber hinaus werden diese Gegenstände als etwas gedacht, das in seiner Bestimmtheit dauernd für sich besteht und wirkt und nicht bloß da ist, wenn es wahrgenommen wird. Dass die Gegenstände der Körperwelt vom Einzelnen und seinen Wahrnehmungen unabhängig existieren, das ist uns im Alltag derart vertraut, dass schon der geringste Zweifel daran zu heftigen Protesten führt. Auch wenn wir sie nur zeitweilig wahrnehmen, z. B. jetzt gerade, oder später oder früher einmal, so sind wir dennoch der Auffassung, dass wir es lediglich mit herausgegriffenen Momenten eines ununterbrochenen, gleichmäßigen Vorhandenseins zu tun haben; dass uns also nur anschaulich wird, was die längste Zeit unabhängig von uns schon so vorhanden war. Aber die Gegenstände der Körperwelt in diesem Sinne — also im Sinne von Objektivität und Dauerhaftigkeit — sind etwas ganz anderes, als uns die Wahrnehmung bietet. Eine Körperwelt, die so gedacht wird, steht im Widerspruch zu dem, was in der Wahrnehmung als Körper vorgefunden wird. Wahrnehmungsinhalte sind zunächst etwas hochgradig individuelles. Nicht bloß individuell verschieden von Person zu Person, sondern immer auch individuell nuanciert und verändert. Was jeder Einzelne wahrnimmt, ist in dieser Weise nur für ihn vorhanden. Wenn die vielen Zuschauer im Theater sitzen, dann bewegen sich vor ihnen die gleichen Objekte; was aber ein jeder Anwesende de facto wahrnimmt, ist nicht das Gleiche, sondern individuell Verschiedenes. Nicht bloß verschieden im Sinne eines individuellen Ausschnitts der Welt, der dem Einzelnen zu einem bestimmten Zeitpunkt gegenwärtig ist, sondern auch verschieden nach Lage, Entfernung und persönlicher Disposition. Was wahrgenommen wird, ist, so wie man es wahrnimmt, nur für jeden Einzelnen da. Wahrnehmungsinhalte implizieren ein irreduzibles Moment der Subjektivität, das sich in Abhängigkeit von der körperlichen Verfassung des Wahrnehmenden, speziell der Verfassung seiner Sinnesorgane, dem Zustand der Umgebung und der Eigenart des Bewusstseins — seinem Erlebnischarakter — konstituiert. Meine Wahrnehmungsinhalte sind nur für mich in dieser Weise da, d. h. sie sind subjektive Phänomene. Aber auch mit der Stetigkeit der objektiven Körperwelt — die ja als eine sich über relativ lange Zeit gleichmäßig und ohne Unterbrechung fortsetzende Welt gedacht wird — steht das Wahrnehmungsgegebene in Konflikt. Es ist ein flüchtiges Bild der Welt, das sich uns in der Wahrnehmung darbietet, von allerhand subjektiven Einflüssen verzerrt und schon im nächsten Wahrnehmungsmoment — wenn ein neuer Ausschnitt der Welt ins Bewusstsein rückt — verloschen. Vergleicht man also das, was in einer Wahrnehmung wirklich vorliegt mit dem, was von einer objektiven, d. h. der physischen Körperwelt gefordert wird, so ergibt sich klar ihre Verschiedenheit. Der Wahrnehmungsinhalt kann nie und nimmer jene objektive Körperwelt konstituieren auf die sich die miteinander verkehrenden Personen beziehen. Es wird nichts geboten, was hierfür geeignet wäre. Sobald man den Gedanken einer objektiven, für sich bestehenden Körperwelt gefasst hat und sie in der Wahrnehmung aufzusuchen und zu bestimmen unternimmt, ergibt sich unausweichlich, dass das Wahrgenommene nicht diese objektive Körperwelt sein kann. Beim Wahrgenommenen muss es sich folglich um eine andere, zweite Welt handeln: eben um eine Welt subjektiver Phänomene. So ergeben sich zwei Welten: auf der einen Seite die Phänomenwelt also die Wahrnehmungswelt, auf der anderen Seite die objektive Körperwelt, die Realwelt. Erstere ist eine Repräsentation Letzterer im Bewusstsein, vielleicht ein Bild, vielleicht bloß ein Zeichen derer, jedenfalls aber nur eine Vertretung, ein Korrelat, nicht die objektive Körperwelt selbst.
Wenn wir nun zusammenfassen und den richtigen Schluss ziehen, so zeigt sich uns ein ganz anderes Bild von den Gegenständen jenseits der Wahrnehmung: Der gesamte Bereich dessen, was wir im Alltag üblicherweise für die objektive Körperwelt, mithin für die Realwelt halten, gehört in Wahrheit zur Phänomenwelt. Die Phänomenwelt wiederum ist die wahrnehmungsimmanente Repräsentation der objektiven Körperwelt. Diesseits der Wahrnehmung finden wir also — wie sich zeigte — keinesfalls die objektive Körperwelt selbst vor, sondern lediglich eine Vertretung derselben, ein Korrelat. Wenn dem aber so ist, dann stellt sich unweigerlich die Frage, wo die objektive Körperwelt selbst zu liegen kommt. Und die einzig richtige Antwort kann nur lauten: jenseits der Wahrnehmung. Jenseits der Wahrnehmung finden sich also wider erwarten weder Gott noch Dämonen oder andere mysteriöse Gegenstände, sondern schlicht und ergreifend Realwelt! Von dieser Warte aus betrachtet, ist die Rede vom Wahrnehmungsjenseitigen an Vernünftigkeit kaum zu überbieten, ist doch die Realwelt der Gegenstandsbereich par excellence der strengsten aller Wissenschaften, der Physik.
Man sieht also: Bringt man die Vorstellungen von der Welt, wie sie uns im Alltag begegnen, ins Wanken, so zeigen sich einem ganz andere Verhältnisse. Das vermeintlich Objektive – die Körperwelt in der Wahrnehmung – offenbart sich als Welt subjektiver Bewusstseinsphänomene und die Realwelt, die wir gerade noch vor unseren Augen glaubten, zeigt sich als eine Welt jenseits der Wahrnehmung, mithin jenseits aller Subjektivität des Bewusstseins. Und mit dieser Einsicht ändert sich dann eben auch die Bestimmung dessen, worüber man vernünftig reden kann.
Autor: Bernd Waß
Diskussionsbeiträge bitte an: b.wass@academia philosophia.com
06.11.2016:Leibniz an der Akademie der Wissenschaften

Es ist der 03. November 2016. Ich reise nach Wien. Die Österreichische Akademie der Wissenschaften richtet ein internationales Leibniz-Symposium aus. Es sind hochkarätige Gelehrte, die aus Anlass des 300. Todestags des berühmten Philosophen, Mathematikers und Erfinders Gottfried Wilhelm Leibniz darüber diskutieren, inwiefern sich die Erkenntnisse Leibnizens auf die heutigen Problem- und Fragestellungen auswirken, die sich uns im Umgang mit Wissenschaft, Gesellschaft und Religion ergeben. Individualität, religiöse Pluralität, die Perspektive des Anderen und der Zusammenhang von Theorie und Praxis sind Felder, die es zu durchmessen gilt, um auf dem Weg einer ständig zu korrigierenden Weltanschauung voranzuschreiten.
Vielleicht sind es vierzig oder fünfzig Menschen, die sich dieser Tage in die ehrwürdigen Hallen der Akademie verirren, vielleicht auch sechzig. Leibniz ersann die Akademien (u. a.) als Bindeglieder zwischen Wissenschaft und Gesellschaft. Der Elfenbeinturm der Gelehrten sollte sich öffnen und das Denken und Erkennen derer, die darin zu Gange sind, auf die Verbesserung der Gesellschaft hin verpflichten. Und wer kommt, wenn man die Türen aufmacht? Dass die Philosophie von jeher eine Randerscheinung ist, ist wenig verwunderlich. Zu befürchten ist allerdings, dass auch das Denken zu einer solchen Randerscheinung wird, und ich meine damit natürlich nicht, das kalkulierende, planende Denken um des ökonomischen Vorteils wegen.
03.11.2016: Kolumne "Philosophisch gedacht"

Die Irrlichter des Glücks
Das Glück des Lebens, so scheint es, ist eine fragile, unstete, ja flüchtige Gestalt. Eben noch glaubten wir sie in unserem Besitz, schon verschwimmen ihre Konturen und bald bleibt nichts zurück, außer jenem gesichtslosen, biografischen Moment vielleicht, den das Glück in unserer Seele zu hinterlassen vermochte. Weder die althergebrachten Mittel der Religionen noch jene der Moderne sind tauglich unser Glück zu konservieren. Selbst die kühnsten Versuche ihm habhaft zu werden scheitern, wie alle anderen, ad infinitum. So wird uns die Jagd nach dem Glück zum Desaster und gleicht der Strafe des Sisyphos, der von den Göttern dazu verurteilt ist, unablässig einen Felsblock einen Berg hinauf zu wälzen, von dessen höchstem Punkt, der Stein von selbst wieder hinunterrollt. Endlich am Gipfel angelangt, auf dem das Glück thront – man könnte sagen, das Weh des Lebens überwunden – entgleitet uns dieses höchste Gut, das Endziel unseres Strebens, wie Aristoteles meinte, und der Gang unserer Geschichte beginnt von Neuem. Das Glück lässt sich nicht greifen, und während sich der Glücksjäger nach der Sehnsucht verzehrt, endlich glücklich zu sein, ist er dem Tod näher als dem Leben. Wozu nun der Philosoph durch allerhand Wortgirlanden sich hier auszudrücken bemüßigt fühlt, das kommt nicht nur ihm, sondern bisweilen auch Anderen in den Sinn: dass nämlich der Mensch womöglich gar nicht zum dauerhaften Glück bestimmt ist, dass sein Leben also über weite Strecken glücklos bleiben wird. Was aber, wenn unsere Auffassung vom Glück ein Irrtum ist? Was, wenn das Glück keine Gestalt ist, die dem Leben erst hinzukommt und aus dem Fluss desselben herausragt; kein Monument besonderer Schönheit, der die Seele auf außergewöhnliche Weise zu rühren vermag, nichts, was dem Leben nicht schon selbst innewohnte? Dann warten wir vergeblich, obwohl das Gesuchte, die ganze Zeit vor unseren Augen liegt. Heilung aber naht! Der Weg zum »wahren« Glück, so tönt es von jeher aus den Hallen der Glücksgurus und spirituellen Führer, führt vom äußeren Glück als dem Glück, das noch hinzukommt, zum inneren Glück als dem Glück, das immer schon da ist. Lediglich die Einsicht, dass sich auch dieses Glück unserem Zugriff entziehen könnte, will sich nicht so recht einstellen. Doch sie liegt nahe: Dass eine unbegrenzt verlängerte Empfindung überhaupt aufhören würde empfunden zu werden, also gar nicht mehr im Bewusstsein existieren würde; dass mithin ein bestimmter Inhalt, der immer in unserem Bewusstsein ist, schlichtweg unbemerkt bliebe, weil wir uns dessen Nichtsein gar nicht vorstellen könnten, mithin sein Vorhandensein nicht mit der Vorstellung seines Fehlens vergleichen und von ihr unterscheiden könnten, das ist ein Verdacht, der nicht nur Hobbes und Schlick gekommen ist. Horribile dictu: Das Glück, das dem Leben hinzukommt, lässt sich nicht greifen und jenes, das ihm dauerhaft innewohnt, bemerken wir nicht. Ein Befund, der es leicht vermag uns ins Unglück zu stürzen. Nicht aber den, der einsieht: Des Menschen Glück, wie sein Leben, gleicht der Aporie des Philosophen. Widersprüchlich in seinen Momenten und ausweglos in seiner Gesamtheit, absurd und fantastisch zugleich. Unverstandene Selbstverständlichkeit.
Autor: Bernd Waß
Diskussionsbeiträge bitte an: b.wass@academia philosophia.com
27.10.2016: Kolumne "Philosophisch gedacht"

Die beste aller möglichen Welten?
Vor dreihundert Jahren stirbt der letzte Universalgelehrte: Gottfried Wilhelm Leibniz. Sein großes Vermächtnis, mit dem er sich den beißenden Spott Voltairs zugezogen hat, und das dem Pessimisten und Desillusionierungsphilosophen Schopenhauer lediglich einen ironischen Kommentar entlockt, ist das Kernstück seiner Metaphysik, die Theodizee und der sie tragende Gedanke, die Welt, in der wir leben, sei die beste aller möglichen Welten. Schwer vorzustellen in einer Welt, die von jeher eine Welt des Krieges und des Leidens ist, und in der uns Hunger, Armut und Not und die Wucht der humanitären Katastrophen zu zerreißen drohen. Doch das Übel in der Welt ist für Leibniz weder der Gegenspieler des Guten noch eine Größe, die wir nicht zu beeinflussen imstande wären. Gutes und Übles sind einander nämlich inhärent. „Wie das minder Üble den Charakter des Guten hat, so hat das minder Gute den Charakter des Üblen“ (Leibniz, Discours de Métaphysique,1686). Das vollkommen Gute wiederum beruht für Leibniz auf vernünftiger Einsicht, woraus folgt: Ein Mangel an Einsicht führt zum minder Guten, und das minder Gute ist bekanntermaßen das relativ Üble. Auch wenn uns die Auffassung Leibniz’, dass allein die Erkenntnis des Guten zur guten Handlung führt, gar zu idealisiert scheint, so ist nichtsdestoweniger die geistige Finsternis zu beklagen, die uns umgibt, in der die Lichter des Verstehens ferne Sonnen sind und das Gute stirbt, ehe es geboren wurde. Die Hoffnung aber, dass sich der Schleier des Nichtwissens heben wird, könnte sich nicht erfüllen. Vom hohen Ross der Vernunft gestürzt, den Geist zum Epiphänomen eines blinden Weltwillens degradiert, ist der Mensch im Rahmen pessimistisch-naturalistischer Weltdeutung eine Marionette der Natur, in seinem Handeln festgelegt wie das Wachstum einer Pflanze. Einzig das Schopenhauersche Mitleid, als die Neigung zur Selbstlosigkeit, könnte uns retten. Mitleid, so schreibt Schopenhauer in der Preisschrift für die Dänische Sozietät der Wissenschaften, ist die moralische Triebfeder schlechthin. „Denn grenzenloses Mitleid mit allen lebenden Wesen, ist der festeste und sicherste Bürge für das sittliche Wohlverhalten […]. Wer davon erfüllt ist, wird zuverlässig Keinen verletzen, Keinen beinträchtigen, Keinem wehe tun, vielmehr mit Jedem Nachsicht haben, Jedem verzeihen, Jedem helfen, so viel er vermag, und alle seine Handlungen werden das Gepräge der Gerechtigkeit und Menschenliebe tragen“. Bleibt nur noch die Frage, warum wir uns derart zurückhalten, dort, wo die Verschwendung in ehrbarer Gestalt auftreten könnte.
Autor: Bernd Waß
Diskussionsbeiträge bitte an: b.wass@academia philosophia.com
23.10.2016: Kunstgespräch mit Dieter Huber

Am Tisch 74 diskutierten wir mit dem international erfolgreichen, in Salzburg lebenden und schaffenden, Künstler Dieter Huber (dieter-huber.com). Aus dem Blickwinkel des Künstlers, der Kunsthistorikerin, des Sammlers und des Philosophen stellten sich uns die Fragen nach dem Wesen und der Aufgabe der Kunst am Beginn des dritten Jahrtausends. Es interessierte uns das Verhältnis von Motiv, Werk, Rezipient und Kunst, die Methodologie künstlerischer Bezugnahme auf Welt und Mensch, aber auch der Einfluss eines mächtigen, von Galeristen und Rendite-Hungrigen Käufern beherrschten, Kunstmarktes auf die Qualität und die Aussagekraft moderner Kunst.
20.10.2016: Kolumne "Philosophisch gedacht"

Der Hausverstand — ein überheblicher, nichtsnutziger Münchhausen
Nicht zuletzt dank der Werbung eines österreichischen Lebensmittelunternehmens ist der „Hausverstand“ wieder ins Zentrum der Aufmerksamkeit gerückt. Es scheint so, als wäre er nicht nur eine zuverlässige Quelle für persönliche Entscheidungen, sondern auch ein Garant für die nachhaltige Entwicklung von Unternehmen, die Beantwortung politischer und gesellschaftlicher Fragen, ein gedeihliches Miteinander oder die Lösung komplexer ökologischer Probleme. In der Philosophie ist diese Sache betreffend vom Commonsense oder Alltagsdenken oder auch vom gesunden Menschenverstand die Rede. Aber taugt der gesunde Menschenverstand wirklich dazu, eine Weltanschauung zu entwerfen und eine Handlungsorientierung hervorzubringen, die der Komplexität moderner Lebenswelten gerecht wird? Oder ist er nur ein überheblicher, nichtsnutziger Münchhausen?
Etwa im 18. Jh. rückt der gesunde Menschenverstand ins Zentrum philosophischer Aufmerksamkeit. Seither versteht man darunter das Vermögen, Sachverhaltserkenntnis und Handlungsorientierung in komplexen Zusammenhängen zu erlangen, ohne dabei auf explizite, rationale Operationen bzw. Verfahren zurückzugreifen. Noch deutlicher wird die Angelegenheit bei Thomas Reid, dem Begründer der sogenannten Common-Sense-Philosophie, jener philosophischen Strömung, die den gesunden Menschenverstand nicht nur als taugliches Erkenntnisvermögen in Alltagsdingen begreift, sondern ihn auch als Fundament philosophischer Theorien forderte. Für Reid befähigt uns der gesunde Menschenverstand, die Wahrheit zu erkennen, und zwar nicht auf dem Umweg etwa des logischen Schlussfolgerns, des Überlegens und Abwägens, des Argumentierens und Begründens oder anderer rationaler Verfahren, wie sie beispielsweise Mathematik, Geometrie oder formale Logik bereitstellen, sondern durch sofortige, intuitive Einsicht. Er beruht weder auf Ausbildung noch auf Gewohnheit, sondern ist naturgegeben. Man könnte vielleicht auch von einem robusten, nicht fehlerlosen aber doch nicht allzu fehleranfälligen, bodenständigen, allen Menschen gleichermaßen gegebenen, Erkenntnisvermögen sprechen. Während also Thomas Reid den gesunden Menschenverstand sowohl in intellektueller als auch lebenspraktischer Hinsicht zum Dreh- und Angelpunkt allen Denkens macht, ist das Urteil seiner Kritiker vernichtend. Für Immanuel Kant etwa hat der Auftritt des gesunden Menschenverstandes zwar in alltäglichen Dingen gewisse Berechtigung, doch letztlich ist er nichts weiter als ein bequemes Hilfsmittel, ein Orakel, ein Urteil der Menge, dem unangemessenerweise auch dort vertraut wird, wo sich Erkenntnis lediglich auf logische Zusammenhänge gründet. Für Georg Wilhelm Hegel wiederum gibt er nur eine Rhetorik trivialer Wahrheiten zum Besten und ist nichts anderes als die Denkweise einer Zeit, in der alle Vorurteile dieser Zeit enthalten sind. Und Friedrich Nietzsche bemerkt verächtlich, dass er nichts anderes sei als ein ekelhafter Allerweltsglaube.
Gründe genug, den gesunden Menschenverstand einer philosophischen Prüfung zu unterziehen. Das Ergebnis dieser Prüfung Der gesunde Menschenverstand – eine philosophische Kritik finden Sie, alphabetisch gereiht, in der Rubrik Publikationen.
Autor: Bernd Waß
Diskussionsbeiträge bitte an: b.wass@academia philosophia.com
14.10.2016: Philosophisch-literarisches Symposion

Im Hauptquartier des Philosophen hob das erste philosophisch-literarische Symposion des Spätjahres 2016 an. Mit Friedrich Nietzsche und Franz Kafka waren nicht nur zwei herausragende Geister eingeladen, sondern auch zwei verborgene, sich nicht gleich und nicht jedem preisgebende: Nietzsche, der Zukunftsphilosoph, der Antichrist, dessen Zarathustra mit dem Gestus eines Gottes zur großen Demontage des Jenseitigen ausholt und in der Überwindung des Menschen im Übermenschen, die große, alles überstrahlende Sonne der geistigen Freiheit erblickt und Kafka, der von Versagensängsten geplagte Versicherungsangestellte, der ein, wie er selbst sagt, Manöver-Leben-Führende und vormittags Bürostunden leistende, nachmittags schlafende und nachts schreibende Literat, dessen Werk wir heute zum Kanon der Weltliteratur zählen. Ohne Zweifel: zwei gewaltige Leuchtfeuer in einer sich rasch verdunkelnden Zeit der geistigen Dekadenz.
13.10.2016: Kolumne "Philosophisch gedacht"

Die Sichtweise der Tiere
In der Tageszeitung DerStandard vom 13.Oktober 2016 ist zu lesen, dass Forscher der Universitäten Stanford und Connecticut in der Lage sind, per virtual reality, Menschen die Sichtweise von Tieren einnehmen zu lassen. Die Wissenschaftler hoffen darauf, dass sich unser Mitgefühl gegenüber Tieren verbessert, wenn wir virtuell etwa einen Schlachttransport aus der Sicht einer Kuh erleben oder die Verschmutzung der Meere aus der Sicht einer Koralle. Das ist erstaunlich und zeigt einmal mehr, dass man es in den viel beachteten, faktenaufweisenden Wissenschaften mit dem Denken häufig nicht gar so ernst nimmt, ist es uns doch aus erkenntnislogischen Gründen prinzipiell unmöglich eine solche Sichtweise einzunehmen. Der Philosoph Thomas Nagel macht die erkenntnislogischen Probleme in seinem Aufsatz ‘Wie ist es, eine Fledermaus zu sein?’ deutlich:
“Ich nehme an: Wir alle glauben, daß Fledermäuse Erlebnisse haben. Schließlich sind sie Säugetiere, und es gibt keinen größeren Zweifel daran, daß sie Erlebnisse haben als daran, daß Mäuse, Tauben oder Wale Erlebnisse haben. […] Obwohl Fledermäuse uns näher verwandt sind als diese anderen Arten, weisen sie einen Sinnesapparat und eine Reihe von Aktivitäten auf, die von den unsrigen so verschieden sind, daß das Problem das ich vorstellen möchte besonders anschaulich ist (obwohl es gewiß auch anhand anderer Arten aufgeworfen werden könnte).
[…] Das Wesentliche an dem Glauben, daß Fledermäuse Erlebnisse haben, [ist], daß es irgendwie ist, eine Fledermaus zu sein. Heute wissen wir, daß die meisten Fledermäuse […] die Außenwelt primär durch Radar oder Echolotortung wahrnehmen, indem sie das von den Objekten in ihrer Reichweite zurückgeworfene Echo ihrer raschen und kunstvoll modellierten Hochfrequenzschreie registrieren. Ihre Gehirne sind dazu bestimmt, die Ausgangsimpulse mit dem darauf folgenden Echo zu korrelieren. Die so erhaltene Information befähigt Fledermäuse, eine genaue Unterscheidung von Abstand, Größe, Gestalt, Bewegung und Struktur vorzunehmen, die derjenigen vergleichbar ist, die wir beim Sehen machen. Obwohl das Fledermaus-Radar klarerweise eine Form von Wahrnehmung ist, ist es in seinem Funktionieren keinem der Sinne ähnlich, die wir besitzen. Auch gibt es keinen Grund zu der Annahme, daß es subjektiv so wie irgendetwas ist, das wir erleben oder das wir uns vorstellen können. Das scheint für den Begriff davon, wie es ist, eine Fledermaus zu sein, Schwierigkeiten zu bereiten. Wir müssen überlegen, ob uns irgendeine Methode erlauben wird, das Innenleben der Fledermaus aus unserem eigenen Fall zu erschließen, und falls nicht, welche alternativen Methoden es geben mag, um sich davon einen Begriff zu machen.
Unsere eigene Erfahrung liefert die grundlegenden Bestandteile für unsere Phantasie, deren Spielraum deswegen beschränkt ist. Es wird nicht helfen, sich vorzustellen, daß man Fluggeräte an den Armen hätte, die einen befähigen, bei Einbruch der Dunkelheit und im Morgengrauen herumzufliegen, während man mit dem Mund Insekten finge; daß man ein schwaches Sehvermögen hätte und die Umwelt mit einem System reflektierter akustischer Signale aus Hochfrequenzbereichen wahrnähme; und daß man den Tag an den Füßen hängend in einer Dachkammer verbrächte. Insoweit ich mir dies vorstellen kann (was nicht sehr weit ist), sagt es mir nur, wie es für mich wäre, mich so zu verhalten, wie sich eine Fledermaus verhält. Das aber ist nicht die Frage. Ich möchte wissen, wie es für eine Fledermaus ist, eine Fledermaus zu sein. Wenn ich mir jedoch dies nur vorzustellen versuche, bin ich auf die Ressourcen meines eigenen Bewusstseins eingeschränkt, und diese Ressourcen sind für das Vorhaben unzulänglich. Ich kann es weder ausführen, indem ich mir etwas zu meiner gegenwärtigen Erfahrung hinzudenke, noch indem ich vorstelle, Ausschnitte würden davon schrittweise weggenommen, noch indem ich mir Kombinationen aus Hinzufügungen, Wegnahmen und Veränderungen ausmale.
Bis zu dem Grade, in dem ich mich wie eine Wespe oder eine Fledermaus verhalten kann, ohne meine grundlegende Gestalt zu verändern, würden meine Erlebnisse gar nicht wie die Erlebnisse dieser Tiere sein. Auf der anderen Seite ist es zweifelhaft, ob der Annahme, ich besäße die innere physiologische Konstitution einer Fledermaus, irgendeine Bedeutung gegeben werden kann. Selbst wenn ich schrittweise in eine Fledermaus verwandelt werden könnte, könnte ich mir in meiner gegenwärtigen Konstitution überhaupt nicht vorstellen, wie die Erlebnisse in einem solchen zukünftigen Stadium meiner Verwandlung beschaffen wären. Die besten Indizien würden von den Erlebnissen von Fledermäusen kommen, wenn wir nur wüßten, wie sie beschaffen sind. […] Das Problem ist jedoch nicht nur auf exotische Fälle beschränkt; es besteht nämlich auch zwischen zwei Personen. Der subjektive Charakter der Erfahrung einer z.B. von Geburt an tauben und blinden Person ist mir nicht zugänglich, und wahrscheinlich ihr auch der meinige nicht […].” (Nagel, Thomas: Wie ist es, eine Fledermaus zu sein?, in: Bieri, Peter: Analytische Philosophie des Geistes, Beltz Verlag, Weinheim und Basel, 2007, S. 263-265.)
Was für Fledermäuse gilt, gilt aber nicht nur für Kühe, Korallen und Menschen, die von Geburt an taub und blind sind. Denn auch die Frage nämlich, wie es ist, der Verfasser dieser Kolumne zu sein, kann weder von meinem Nachbarn noch von einem Wissenschaftler noch von irgendjemand anderem vollständig eingesehen werden, sondern ausschließlich vom Verfasser dieser Kolumne selbst. Auch wenn sich z. B. ein Wissenschaftler in meine Erlebnisperspektive hineinversetzen kann und sich vorstellen kann, wie es ist, der Verfasser dieser Kolumne zu sein, so kann er dies dennoch nur aus seiner Perspektive, und diese Perspektive ist mit der meinen nicht identisch, oder anders formuliert, sie ist von meiner zu jedem Zeitpunkt um eine Nuance verschieden. Dass es jemals einen Zeitpunkt geben könnte, an dem die Perspektive des Wissenschaftlers mit meiner Perspektive identisch ist, ist unmöglich, denn gäbe es einen solchen Zeitpunkt, so wäre dieser Wissenschaftler ich. Dann allerdings würde er nicht erleben, wie es ist ich zu sein, sondern lediglich wie es ist, er selbst zu sein. Damit wäre aber nichts erreicht.
Natürlich können wir uns darum bemühen, die Sichtweisen anderer Lebewesen einzunehmen, ihnen sozusagen näher zu kommen, um etwa ein besseres Verständnis davon zu entwickeln, welchen Einfluss unser Handeln auf ihr Erleben hat. Doch dies kann nur in einem übertragenen Sinn gemeint sein, denn ihre Sichtweise wirklich einzunehmen ist aus erkenntnislogischen, und letztlich auch ontologischen, Gründen ganz und gar unmöglich.
Autor: Bernd Waß
Diskussionsbeiträge bitte an: b.wass@academia philosophia.com
05.10.2016: Kolumne "Philosophisch gedacht"

Zerstörung, Tod und in letzter, tiefster Verzweiflung Flucht
Syrien, Boko Haram, Islamischer Staat, Terror in Frankreich, Brüssel und im Rest der Welt: Der Krieg — nicht zuletzt der Krieg um eine neue Weltordnung — geht mit unverminderter Härte weiter. Unter der billigenden, taktierenden, eingreifenden Hand der Großmächte wird Völkerrecht gebrochen und Völkermord begangen: Zerstörung, Tod und in letzter, tiefster Verzweiflung Flucht. Und die Europäische Union? Ein wohlständiges, hoch technisiertes und akademisiertes Konglomerat aus wohlständigen, hoch technisierten und akademisierten Nationalstaaten erstarrt, wird gar zum Spielball billiger, rechter Propaganda. Da hätten wir als vereintes Europa zum ersten Mal seit dem zweiten Weltkrieg die Gelegenheit Größe zu zeigen, unserer humanitären Pflicht nachzukommen, stattdessen: Zäune, Internierungslager, Chaos.
Die Philosophin Hannah Arendt veröffentlichte 1943 ein Essay mit dem Titel We Refugees. Darin zeichnet sie die Lebensgeschichte des Herrn Cohn nach, der sich als jüdischer Flüchtling mit äußerster Anstrengung bemüht, mit den Menschen seiner neuen »Heimat« zu assimilieren. Doch letztlich, so Arendt, müssen alle Anstrengungen eines Flüchtlings zu jenen zu gehören, die ihn nicht haben wollen, erfolglos bleiben. Als Staatenloser ist er rechtlos und vogelfrei. Am Ende seines Weges muss sich Herr Cohn eingestehen: Das Glück des Lebens kann man nicht zweimal finden.
Wie wenig hat sich doch geändert, trotz aller Bildung, allen technischen und wirtschaftlichen Fortschritts. Wie schnell zücken wir auch heute das Schwert des Vorurteils und stellen uns — die Anhörung vergessend — zum Tribunal der Verurteilung zusammen. Wie fragil ist das Gebäude der überlegenden Vernunft und wie schnell bricht es unter der Last der Propaganda in sich zusammen. Schauderhaft. Vielleicht vermag es ja die Kunst, die Poesie oder die Dichtung, die dunkle Nacht unserer Zeit zu erhellen. Ich zweifle. Dennoch: Ein Ruf der Besinnung von nirgendwo des großen Georg Danzer:
er spürt die sun in seine augen
er spürt den wind in seine haar
er riacht des wasser drunt am ufer
und alles is so nah und klar
er siecht die hügel und die felder
des grüne land in sein tram
was is von alledem no übrig
verbrannte erd, verkohlte bam
ka mensch verlaßt sei heimat ohne grund
ka mensch wü gern a fremder sei
und sei verzweiflung in der letzten stund
is stumm wia a erstickter schrei
er spürt a grenzenlose panik
wie ana, der im fluß ertrinkt
umgeb'n von menschen, die nur zuschaun
um eam wird's schwarz und er versinkt
ka mensch geht freiwüllich so afoch fort
von dort, wo seine wurzeln san
ka mensch wü sterben an an fremden ort
verkauft, veraten und allan …
ka mensch verlaßt sei heimat ohne grund
ka mensch wü gern a fremder sei
und sei verzweiflung in der letzten stund
is stumm wia a erstickter schrei …
Autor: Bernd Waß
Diskussionsbeiträge bitte an: b.wass@academia philosophia.com
29.09.2016: Kolumne "Philosophisch gedacht"

Das Märchen von der Gerechtigkeit – eine Hinzufügung
In der aktuellen Ausgabe der ZEIT, N°40/2016, findet sich eine Reportage mit dem Titel „Das Märchen von der Gerechtigkeit“. Doch statt von Gerechtigkeit ist von Ungleichheit die Rede, werden Fakten aufgewiesen, wie es um die Verteilung bestimmter Güter bestellt ist, dienen Arme und Reiche als Grenzpunkte einer Debatte. Philosophisch gesehen insofern unbefriedigend, als Gerechtigkeit und Ungleichheit zwei paar Schuhe sind: Sie stehen nicht zwingend zueinander im Widerspruch, und auch wenn man alles über die Ungleichheit weiß, so weiß man längst nicht alles über die Gerechtigkeit. Ich erlaube mir daher, im Sinne der Fruchtbarkeit der Debatte, eine Hinzufügung.
Die Frage nach der Gerechtigkeit ist zuallererst eine Aufforderung, uns eine genaue Vorstellung davon zu machen, wovon überhaupt die Rede ist. Das könnte sich als schwierig erweisen. Machen wir uns daher zunächst klar, wovon jedenfalls nicht die Rede ist: Es ist nicht die Rede von den Rechtssystemen. Wer sein Recht bekommt, der bekommt es nicht der Gerechtigkeit wegen, sondern der Übereinstimmung seiner persönlichen Interessen mit gültigen Gesetzen wegen. Gerechtigkeit ist nämlich zunächst keine Frage der Gesetzgebung, sondern der Moral. Zwar ist anzunehmen, dass eine Gesetzgebung letztlich die moralische Gerechtigkeitsauffassung einer Gesellschaft impliziert, doch Rechtsurteil und Gerechtigkeit sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Gerechtigkeit ist aber auch kein Naturphänomen. Die Natur als solche ist gleichermaßen gerechtigkeitsindifferent wie sie moralisch indifferent ist und weder Gerechtigkeit noch Moral sind in ihr zu finden. Der evolutionäre Übergang von dem einen Naturzustand in den anderen ist ein nicht-intentionales, nicht-teleologisches Geschehen, was von Gerechtigkeit und Moral zu behaupten hingegen falsch wäre. Gerechtigkeit endlich ist auch keine Empfindung, weder eine äußere noch eine innere, nichts, was der Mannigfaltigkeit der Perzeption, der Affekte oder dem Kaleidoskop der Stimmungen und Sehnsüchte angehört. Würde sich die Gerechtigkeit lediglich in einer Art Gerechtigkeitsgefühl ausdrücken, so müsste das Projekt ‘Gerechtigkeit’ von vornherein als gescheitert betrachtet werden. Aus der Nicht-Identität der Subjekte folgt nämlich die radikale Verschiedenheit ihrer Empfindungen und weil es keine Brücke gebe, um die Kluft zwischen den subjektiven Empfindungszusammenhängen zu überwinden, bliebe die Frage nach der Gerechtigkeit im Dunklen. Es geht also nicht darum, was der einzelne für gerecht hält, sondern was vernünftigerweise gerecht ist. Wenn aber die Gerechtigkeit weder Recht, noch Naturphänomen und auch nicht Empfindung ist, was ist sie dann? Schlechthin ein Gedankenwesen! Gerechtigkeit ist eine Sache des Denkens, eine Gestalt der Vernunft, allein vom menschlichen Geist hervorgebracht. Denn: Ihr Modus Operandi ist der Vergleich — das Erkennen von Gleichheit oder Verschiedenheit. Ohne Zweifel: Wer von Gerechtigkeit spricht, der vergleicht. Jeder Vergleich aber bedarf eines Prinzips, um das miteinander Verglichene in die richtige Ordnung zu bringen und dieses Ordnen der Welt nach Prinzipien, ist das Geschäft der Vernunft. Wer also nach Gerechtigkeit fragt, der muss nach einem Prinzip derselben Ausschau halten; der muss sich fragen: Wer schuldet in welchen Umständen wem was, auf welche Weise, warum, aus welcher Perspektive, aufgrund welchen Maßstabs und mit welcher Anwendung? Fragen der Gerechtigkeit betreffen also mindestens folgende Dimensionen: (1) die Umstände, (2) die Objekte, (3) die Subjekte, (4) den Umfang, (5) die Begründungsperspektive, (6) die Gründe, (7) die Arten und (8) die Maßstäbe der Gerechtigkeit.
Beginnen wir bei den Umständen der Gerechtigkeit. Sie legen fest unter welchen sozialen Bedingungen Gerechtigkeit überhaupt erst erforderlich ist. Der berühmte schottische Philosoph David Hume charakterisierte die Umstände der Gerechtigkeit wegweisend durch zwei Bedingungen: gemäßigte Knappheit und konkurrierende Ansprüche. Nur wenn es konkurrierende Ansprüche auf knappe Güter gibt, wird eine gerechte Lösung bei ihrer Verteilung verlangt. Bei Überfluss können alle Wünsche erfüllt werden und bei extremer Knappheit ist zweifelhaft, ob es überhaupt eine gerechte Lösung geben kann.
Von den Umständen der Gerechtigkeit zu den Objekten der Gerechtigkeit. Mit den Objekten der Gerechtigkeit sind zunächst nicht die Güter gemeint, die es zu verteilen gilt, sondern wesentlich die Frage, wer oder was als gerecht bzw. ungerecht bezeichnet werden kann. Das kann nämlich vieles sein: Personen, deren Handlungen, Verhaltensweisen, Einstellungen und Charaktere ebenso, wie ihre Urteile, Einschätzungen und Wertungen. Darüber hinaus können Verfahren, Normen, soziale Institutionen, politische Zustände, Staaten, Wirtschaftssysteme, Gesellschaftsordnungen und internationale Beziehungen gerecht oder ungerecht genannt werden. Aber auch auf Sportwettkämpfe, Bewerbungsverfahren oder gar auf den Verlauf eines ganzen menschlichen Lebens lassen sich die Prädikate ‘gerecht’ und ‘ungerecht’ sinnvoll anwenden. Man muss also klären, worüber man redet. Es macht einen Unterschied, ob man Gerechtigkeit z. B. im Hinblick auf ein Bewerbungsverfahren diskutiert oder im Hinblick auf politische Zustände.
Noch interessanter als die Objekte, sind die Subjekte der Gerechtigkeit. Mit der Frage nach den Subjekten der Gerechtigkeit werden wir nämlich auf uns selbst zurückgeworfen. Gerechtigkeit bezieht sich, jedenfalls verantwortungstheoretisch betrachtet, ausschließlich auf Personen, nicht auf Staaten, nicht auf Gesellschaften, nicht auf Organisationen. Demgemäß sind primär wir es, die für die Gerechtigkeit in der Welt moralisch verantwortlich sind. Wir sind es, die ihr Vorschub leisten, sie vernachlässigen oder sie verhindern.
Kommen wir zum Umfang der Gerechtigkeit: Spätestens hier erhitzen sich die Gemüter. Es stellt sich nämlich die Frage, wem gegenüber prinzipiell Gerechtigkeit geschuldet wird, und damit die Frage, ob Gerechtigkeit global und grenzenlos gedacht werden muss, oder aus begrifflichen, normativen oder vielleicht pragmatischen Gründen eher nur lokal, in einer Gemeinschaft oder einer staatlich verfassten Gesellschaft zu verorten ist. Partikularisten vertreten die Auffassung, dass Gerechtigkeit stets an einen konkreten Kontext gebunden ist – an eine kulturelle Gemeinschaft, und zwar schlichtweg deshalb, weil es eine besondere, enge moralische Bindung innerhalb von Gemeinschaften gibt. Universalisten wiederum vertreten die Auffassung, dass jeder Partikularismus schon alleine deshalb verworfen werden muss, weil er jedenfalls dem Artikel 1 der Menschenrechtskonvention der Vereinten Nationen widerspricht. Dort heißt es nämlich: „Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren. Sie sind mit Vernunft und Wissen begabt und sollen einander im Geiste der Brüderlichkeit begegnen.“
Eine Frage, die uns unmittelbar zur Begründungsperspektive der Gerechtigkeit führt. Wir halten uns an Regeln gemeinhin nur solange, solange sie uns als gerechtfertigt, d.h begründet erscheinen. Ein wichtiger Aspekt in diesem Zusammenhang ist die Perspektive der Unparteilichkeit. Die Regeln müssen nicht nur unparteiisch angewendet, sondern auch unparteiisch begründet werden. Mit anderen Worten: Die Gründe dafür, dass diese Regeln gelten und nicht andere, dürfen nicht auf den Eigeninteressen derer ruhen, die sie zu begründen suchen. Ein Gerechtigkeitsbegriff der auf Parteilichkeit beruht, ist von vornherein, weil in sich widersprüchlich, wertlos.
Von der Begründungsperspektive der Gerechtigkeit ist es nicht mehr weit zu den Gründen der Gerechtigkeit. Warum sollen wir überhaupt gerecht sein? Gibt es wirklich gute Gründe dafür oder wäre es nicht vernünftiger, würde jeder seinen eigenen Vorteil zu verwirklichen suchen? Im Verlauf der philosophischen Gerechtigkeitsdebatte der letzten zweieinhalbtausend Jahre wurde eine ganze Reihe von Gründen ins Feld geführt, die für die Gerechtigkeit als Handlungsmaxime sprechen. Sie lassen sich im wesentlichen in zwei Klassen einteilen: In die Klasse der Gründe, die den wechselseitigen Vorteil aller beteiligten hervorheben und in die Klasse der Gründe, die ein Recht auf Gerechtigkeit voraussetzen. Unabhängig davon, welche Klasse von Gründen bevorzugt wird, wer Gerechtigkeit einfordert, der muss in letzter Konsequenz gute Gründe dafür haben.
Nun zum vorletzten Punkt, zu den Arten der Gerechtigkeit. Man unterscheidet zwischen Ausgleichsgerechtigkeit, Verfahrensgerechtigkeit und Verteilungsgerechtigkeit. Vor allem die Verteilungsgerechtigkeit ist es, die mit Blick auf die aktuellen, nationalen wie globalen Entwicklungen in Wirtschaft und Gesellschaft, und durchaus unter Rückgriff auf die politischen Zuständigkeiten, von zentraler Bedeutung ist. Gerechtigkeit in diesem Sinn bezieht sich nämlich auf die Regelung zwischenmenschlicher Konflikte bei der Verteilung von Gütern bzw. Vorteilen und Lasten des sozialen Zusammenlebens.
Womit wir bei der letzten Dimension angekommen wären, bei der Frage nach den Maßstäben der Gerechtigkeit, mithin den Maßstäben der Verteilung. Sie sind der Kern einer jeden Gerechtigkeitskonzeption. Alle modernen Konzeptionen haben ein gemeinsames Fundament: Die prinzipielle Gleichwertigkeit aller Menschen. Unterschiede in den Konzeptionen ergeben sich lediglich durch verschiedene Auffassungen über das Gerechte unter Gleichen. Bei der Verteilung von Gütern und Lasten etwa gilt ein Verteilungszustand als gerecht, wenn es eine Lösung des Problems der Verteilung gibt, die gerechtfertigt werden kann, und sich die Güter und Lasten theoretisch in einem eigentumsfreien Zustand befinden. Außerdem müssen Sie von jedem als Gut begehrt oder als Last gemieden werden. Eine der wichtigsten Konzeptionen stammt vom Philosophen John Rawls. Rawls ist etwa der Auffassung, dass z.B. Einkommen und Vermögen prinzipiell gleich zu verteilen ist, es sei denn, eine ungleiche Verteilung gereicht allen, auch den Schlechtestgestellten, zum Vorteil. Darüber hinaus hat Rawls einen Aspekt der Gerechtigkeit formuliert, der bis dahin weder gesehen noch diskutiert wurde. Dass wir Maßstäbe brauchen, um Güter und Lasten einer Gesellschaft gerecht zu verteilen ist eine Sache; dass es aber darauf ankommt, dass wir sie auf gerechte Weise hervorbringen, eine ganz andere. Nur solche Maßstäbe nämlich sind brauchbar, die unter gerechten Ausgangsbedingungen zustande kommen. Alle anderen sind qua Gerechtigkeit von vornherein unbrauchbar.
Autor: Bernd Waß
Diskussionsbeiträge bitte an: b.wass@academia philosophia.com
22.09.2016: Kolumne "Philosophisch gedacht"
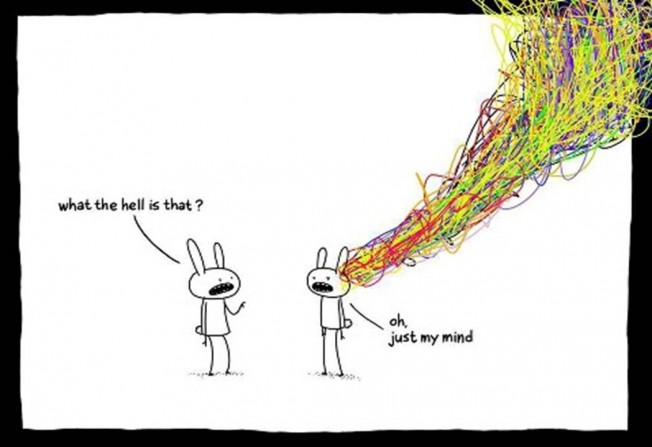
Was bleibt vom Geist?
Mit dem Human Brain Projekt initiierte die Europäische Union das wohl größte interdisziplinäre Forschungsprojekt der bisherigen europäischen Wissenschaftsgeschichte. Sage und schreibe eine Milliarde Euro fließt auf diese Weise in die Aufklärung der komplexen Mechanismen des menschlichen Gehirns. Befragt man führende Hirnforscher, wie etwa Wolf Singer, so leitet die Hirnforschung derzeit, nicht zuletzt ob ihrer großen Fortschritte, einen Paradigmenwechsel ein. In einem aktuellen Interview mit der Tageszeitung DerStandard sagt Singer: „Wir begreifen immer mehr, dass das Gehirn ein sich selbst organisierendes komplexes System ist. Eine hochgradig nichtlineare Dynamik bereitet all unsere mentalen Prozesse vor — einschließlich der Inhalte, die uns gar nicht ins Bewusstsein kommen. Wir können nicht davon ausgehen, dass es irgendwo im Gehirn eine federführende Instanz gibt, die für uns die Zukunft plant oder Entscheidungen fällt, vielmehr organisieren sich diese Prozesse selbst. Auf wundersame Weise finden Sie zu koordiniertem Verhalten. Das scheint der Weisheit letzter Schluss zu sein – das ist etwas, woran man sich erst einmal gewöhnen muss.“
Seit fast zehn Jahren beschäftige ich mich nun aus philosophischer Perspektive mit der Frage nach dem Verhältnis von Gehirn und Geist. Anlässlich des Singer-Interviews stelle ich in dieser Ausgabe meiner Kolumne wieder einmal die Frage: Was bleibt vom Geist?
Die meisten Neurowissenschaftler und Philosophen, die sich zum Verhältnis von Gehirn und Geist äußern, vertreten heute die Ansicht, geistige Phänomene, wie z. B. Bewusstsein, Wahrnehmungen, Empfindungen, Gefühle oder Gedanken, seien in letzter Konsequenz nichts anderes als Hirnvorgänge. Dementsprechend wird behauptet, wir seien „nichts weiter als ein Haufen Neurone“ (Crick, F. H.: Was die Seele wirklich ist, 1994). Man ist der Auffassung, dass einer vollständigen Erklärung unseres Gehirns, eine vollständige Erklärung unseres geistigen, mentalen oder seelischen Lebens inhärent ist. Mit anderen Worten: Wenn die Geschichte des Gehirns erzählt ist, dann ist auch die Geschichte des menschlichen Geistes erzählt. Es gibt nichts, was über die neuronalen Prozesse in unserem Gehirn hinausreicht und nicht im Prinzip in der Sprache der Physik erklärbar wäre. Alle geistigen Phänomene sind dieser Auffassung nach vollständig auf Hirnvorgänge reduzierbar. Sie sind keine echten Bausteine der Wirklichkeit, die eine eigene kausale Rolle spielen würden oder sich einer physikalischen »Vermessung« entzögen. Die Gesamtheit der konkreten Realität erschöpft sich in den von der Physik angenommenen Elementarteilen oder in Aggregaten solcher Teilchen. Einen von allen physischen Dingen verschiedenen nicht-physischen Geist gibt es nicht. Man nennt diese Position auch Physikalismus. Der Physikalismus gilt heute als die offizielle Doktrin, ja er sieht sich als die einzig rationale Position zum Verhältnis von Gehirn und Geist. Aber ist der Physikalismus wahr? Sind wir wirklich nur unser Gehirn? Sind geistige, mentale oder seelische Phänomene tatsächlich nichts anderes als Hirnvorgänge? Ich vertrete die Auffassung, dass der Physikalismus mit ziemlicher Sicherheit falsch ist. Er scheitert an einer Reihe von Argumenten, die allesamt zeigen, dass sich nicht alle geistigen Phänomene vollständig auf Hirnvorgänge reduzieren lassen. Die Sphäre des Geistigen greift über ihre neuronale Basis irreduzibel hinaus. Das ist auch der Grund, weshalb die Rede vom Gehirn, im Sinne einer ausschließlich physikalischen Erklärung von uns selbst, wie sie derzeit vor allem in der Neurobiologie Mode ist, wesentlich zu kurz greift. Wenn in deren Gefolge seitenweise von gehirngerechtem Lernen, gehirngerechtem Arbeiten, gehirngerechtem Marketing oder wovon sonst noch allem zu lesen ist, sozusagen als gralsheilige Antwort auf die Probleme moderner Gesellschaften, so ist der Applaus verfrüht. Es kann sich hierbei nämlich nur um eine vernunftlose Sicht der Dinge handeln, in der die philosophischen Probleme weithin übersehen oder nicht für wichtig gehalten werden. Das zeigt sich schon allein am sogenannten mereologischen Fehlschluss. Ein solcher Fehlschluss besteht darin, dass die Eigenschaften eines Ganzen mit den Eigenschaften seiner Teile verwechselt werden — und umgekehrt. Typische Beispiele sind die folgenden. Man sagt etwa so: „Lange bevor wir unsere Willensakte bewusst erleben, hat das Gehirn in seinen motorischen Regionen bereits entschieden, was wir als nächstes tun werden.’; ‘Das visuelle System sieht Farben, erkennt Kanten und Oberflächentexturen und verschmilzt sie dann zu den Gegenständen, welche wir bewusst wahrnehmen’ oder ‘Das Gehirn entwickelt eine ganz eigene Perspektive auf die Wirklichkeit, indem es autobiographische Erinnerungen aktiviert und diese mit seinen fortlaufenden kognitiven Prozessen verknüpft’“ (Metzinger, Thomas: Das Leib-Seele-Problem, 2007). Warum sind solche Aussagen logischer Unsinn? „Das Gehirn denkt nicht, der Mensch als Ganzer denkt. Das Gehirn besitzt auch kein autobiographisches Gedächtnis, denn es hat überhaupt keine Autobiographie, kein eigenes Leben — dies hat nur der Organismus als Ganzer. Das Gehirn interpretiert nichts und es hat auch keine eigene Perspektive. Ein Gehirn ist kein Agent, kein Handlungssubjekt, sondern einfach ein selbstorganisiertes dynamisches System [als Teil eines komplexen Ganzen]. Es ist deshalb auch logischer Unsinn, wenn man sagt, dass bestimmte Teile des motorischen Systems »handeln« oder »Entscheidungen fällen«, oder dass bestimmte sensorische Areale Farben »sehen«, Kanten »erkennen« oder einen Schmerz »empfinden«“ (a. a. O.) Man muss also genau darauf achten, was hier verhandelt wird, ehe man applaudiert. Natürlich muss auch die Philosophie die Kirche im Dorf lassen. Dass alle geistigen Phänomene radikal von Hirnprozessen abhängig sind, dass es sie ohne eine funktionierende Hirnphysiologie nicht gibt, das ist ein Befund der Hirnforschung, den man nicht sinnvoll leugnen kann. Darum geht es aber auch nicht. Worum es geht, sind die (metaphysischen) Schlussfolgerungen, die aus diesem Befund gezogen werden. Sie bergen eine Reihe von Ungereimtheiten in sich, die man nicht einfach als philosophische Haarspaltereien abtun oder verachtungsvoll vom Tisch wischen kann.
Weiterführende Texte finden Sie in der Rubrik “Publikationen”:
Das Leib-Seele-Problem und die Metaphysik des Materiellen
Sind wir wirklich nur unser Gehirn?
Autor: Bernd Waß
Diskussionsbeiträge bitte an: b.wass@academia philosophia.com
20.09.2016: Philosophische Gespräche, Band 2
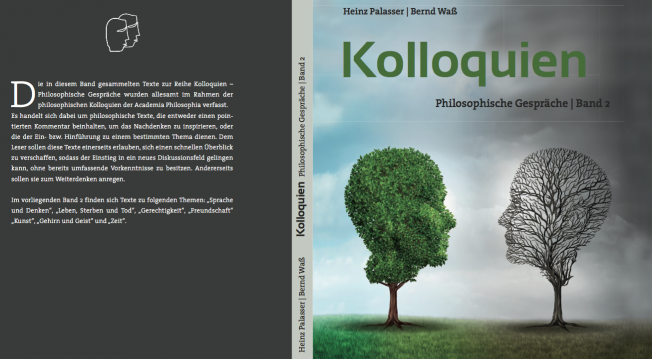
Gemeinsam mit dem Philosophen Heinz Palasser verfasst, ist dieser Tage der zweite Band der philosophischen Gespräche erschienen. Ein Buch mit philosophischen Kurztexten und Aufsätzen, die entweder einen pointierten Kommentar beinhalten, um das Nachdenken zu inspirieren, oder die der Ein- bzw. Hinführung zu einem bestimmten Thema dienen. Im vorliegenden Band 2 finden sich Texte zu folgenden Themen: „Sprache und Denken“, „Leben, Sterben und Tod“, „Gerechtigkeit“, „Freundschaft“ „Kunst“, „Gehirn und Geist” und „Zeit“.
Erhältlich als Paperback, Hardcover und E-Book, im Buchhandel oder direkt im tredition Verlag.
15.09.2016: Kolumne "Philosophisch gedacht"

Können wir uns das leisten?
Warum eigentlich sollen Millionen Euro in akademische Disziplinen fließen, die augenscheinlich kaum oder gar nicht dazu in der Lage sind Nutzen zu stiften?
Oberflächlich betrachtet könnte man meinen, es handle sich um eine ganz simple Frage der Ökonomie. Können wir uns das leisten, in Zeiten wie diesen? Doch in Wirklichkeit ist uns eine tief greifende, fundamentale Frage über die Zukunft unserer Gesellschaft vorgelegt. Die Antwort, die wir uns geben, bestimmt nämlich die Richtung, in die wir gehen: Denn entweder errichten wir eine Diktatur des Nutzens und der Gewinnmaximierung oder wir arbeiten am Pluralismus der Bildung; entweder werden wir eines Tages zu fremdbestimmten, selbstkonsumierenden Produktherstellern und Geschäftemachern verkommen oder wir verwirklichen das große humanistische Ziel der Aufklärung – die Ausbildung freier, autonomer, zum selbstständigen Gebrauch ihrer Vernunft fähigen und davon geleiteten Individuen.
Hört man sich um, so scheint die Antwort eindeutig: Universitäten, am besten gleich die öffentliche Hand als solche, müsse man führen wie Unternehmen. Nur auf diese Weise wäre der gewünschte Output zu erzielen und hätte der verschwenderische, ja geradezu unverantwortliche Umgang mit dem Geld der Steuerzahler ein Ende, so tönt es. Nun gut. Führen wir Universitäten wie Unternehmen: Durchforsten wir sie bis in die kleinsten Winkel; evaluieren wir das Verhältnis von Aufwand und Gewinn, entwickeln wir Effizienzprogramme, setzen wir Produktivitätsmaßnahmen auf, laden wir eine Reihe von Unternehmensberatern ein — freilich nur die besten — und lassen uns erklären, was zu tun wäre, um endlich erfolgreich zu sein; bewerten wir unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und trennen uns von allen, die zwar in höchstem Maße gebildet, aber nichtsdestoweniger zu alt, zu teuer, zu wenig leistungsfähig und zu unflexibel sind, um den Anforderungen unseres modernen Universitätsunternehmens gerecht zu werden; führen wir Managementseminare für die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ein und geben wir Zielvereinbarungen aus. Kurz gesagt: tun wir alles, um erfolgreich zu sein und eliminieren wir alles, was nichts Verwertbares, Umsetzbares, für den Konsumenten, den Bürger unmittelbar Relevantes, augenscheinlich Nützliches, unsere Investoren bei Laune Haltendes, Gewinnmaximierendes, unser Wachstum Förderndes und Macht und Einfluss Vergrößerndes hervorbringt. Produktivität, wohin das Auge schaut. Mediziner, Molekularbiologen, Computerleute, Betriebswirtschafter, Juristen und Techniker arbeiten an der Entwicklung nützlicher und damit gewinnträchtiger Produkte und übernehmen die Ausbildung der jungen Erwachsenen, damit selbige, möglichst rasch in der Lage sind, ebenfalls an der Entwicklung nützlicher und damit gewinnträchtiger Produkte zu arbeiten. Was wäre das für eine Universität! Applaus! Wer braucht schon Philosophen, Philologen, Germanisten, Historiker, Archäologen und dergleichen nutzlose Gelehrte?
Erst viel später, wenn wir eine Gesellschaft aus abgestumpften, geistig amputierten, fremdbestimmten und rund um die Uhr konsumierenden Produktherstellern und Geschäftemachern sind, werden wir, sofern wir überhaupt noch dazu in der Lage sind, erkennen, womit wir es zu tun haben, wird uns das Ausmaß der Tragödie gewahr werden. Und wenn die Revolution gelingt, führen wir dereinst wieder ein, was wir einst aufgegeben haben und für ein gelingendes Leben doch von fundamentaler Bedeutung ist: Literatur, Kunst, Theater, Dichtung, Poesie, Philosophie, Geschichte usf. Mithin: Räume des Denkens, der geistigen und philosophischen Tätigkeit, abseits trivialer Nutzenmaximierung und der unerträglichen Forderung nach Praxistauglichkeit.
Autor: Bernd Waß
Diskussionsbeiträge bitte an: b.wass@academia philosophia.com
- Diskussionsbeitrag von Dr. Peter Gungl, Mediziner
Nachdem ich aus den Naturwissenschaften komme, aus diesen ein kleiner Gedankensplitter zum Thema, ob wir uns Orchideenfächer, nicht primär dem shareholder value dienende, universitäre „Hirnwixereien“ leisten können. Wir müssen sie uns leisten. Wenn wir die Natur betrachten, so erkennen wir, dass sie eine überbordende Vielfalt von Varianten, einen Reichtum an Formen und Farben, eine riesige Palette an Ritualen und Verhalten entwickelt hat, die Energie und Ressourcen verschlingen und von denen Darwin vermutet hat, dass sie irgendwie der Fortpflanzung dienen. Aber mit Verlaub: ein roter Fleck um die Genitalien täts auch. Aber Variantenreichtum macht flexibel für sich verändernde Umweltbedingungen. Und wenn wir einer Tatsache gewiss sein können, dann dieser: Die Welt verändert sich. Sie verändert sich oft nicht so, wie wir es uns vorgestellt hatten (Prognosen sind unsicher, vor allem wenn sie die Zukunft betreffen, haha), und wir tun gut daran, einen Pool an Wissen, Ideen, Phantasien in petto zu haben, um in einer sich verändernden Welt bestehen zu können. Und wenn man die neueste Publikation des Club of Rome nur ansatzweise ernst nimmt, benötigen wir viele neue Ideen, um dem „neoliberal brainwash“ Paroli bieten zu können. Denken wir weiter!
- Diskussionsbeitrag von Dr. Robert Schein
Ich glaube, dass jemand, der sich für eine oder mehrere von Ihnen angeführten Disziplinen (Philosophie, Literatur, Musik, etc …) interessiert, Ihnen keinesfalls widersprechen wird. Ihr zeitdiagnostischer Gedankensplitter beschreibt nicht allein eine Option sondern bereits eine Entwicklung, inmitten welcher wir uns bereits befinden. Ihre Klage findet auch bei mir explizit Resonanz. Die besondere Herausforderung, ja Schwierigkeit, besteht meines Erachten darin, diese Klage den Verantwortungsträgern erschließbar zu machen. Es besteht ja so etwas wie eine Schieflage im Horizontspektrum. Ich meine damit folgendes: Jemandem die Bedeutung und das Potential von Philosophie(n) verständlich zu machen, der selbst nie etwas auch nur in Ansätzen damit zu tun hatte, scheint ein aporetisches Unterfangen. Jemandem beispielsweise die bildungsrelevante Fülle eines ausgezeichneten Lateinunterrichtes zu verdeutlichen, der, neben dem Sprachelernen, ein darüber hinausgehendes Verständnis einer ganzen Kultur, deren Einflüsse noch in die Gegenwart herüberleuchten, zu vermitteln vermag, macht mutlos angesichts eines stumpfen binären Logikbewußtseins, das nur an der Unterscheidung von toten und lebenden Sprachen klebt.
„Verstehen“ bedeutet ganz grundlegend eine vorhandene Differenz zunächst festzustellen und durch Horizonterweiterung zu verringern. Somit ist rationales – oder sagen wir im philosophischen Sinn – vernünftiges Denken niemals bloß starr standpunktverhaftet. Es bedarf also einer Horizonterweiterung. Demnach wäre es auch die Aufklärungsleistung der Philosophie, eben dies zu ermöglichen, d. h. in solchen Diskussionen ihr Selbstverständnis und ihre Verantwortung einer Gesellschaft gegenüber in die Waagschale zu werfen. Und hier scheiden sich schon wieder die Geister, denn es gilt auch bei manchen Philosophen, zumal Fachphilosophen, als wenig schicklich, sich öffentlichen Themen gegenüber auszusetzen. Jene, die das tun – und man mag zu ihnen stehen wie man will – werden zumeist unter Aufbietung eines großen rhetorischen, wenngleich nicht substanziell inhaltlichen, Aufwands öffentlich diffamiert. So werden Texte nach vermeintlich politisch unkorrekten Termini gescannt und dieses Teilsurrogat für das Ganze gehalten. Inhalte werden in selektiver Lektüreabsicht umgelogen. Ungedeckt Gedanken öffentlich zirkulieren zu lassen, gedankliche Versuchsanordnungen in einem zum öffentlichen Schablonenverständnis quer stehenden Setting auszuprobieren, stellen angesichts der Anfeindungen, denen dann Schriftsteller wie Sloterdijk, Safranski, Zizek etc. etc. ausgesetzt sind, ein persönliches Wagnis dar. Wenn man unter dem Begriff der Aufklärung – abseits Kants – einmal jene Variante der französischen Enzyklopädisten versteht, dann besteht gerade dort der Anspruch, nicht nur das Wissen der Zeit zu sammeln, sondern vor allem dieses Wissen dem Gemeinwesen verfügbar zu machen. Ein Dilemma heutzutage besteht ja auch darin, dass das Wissen in den verschiedenen Experten-Communities verbleibt und seinen Weg gerade nicht nach aussen findet. Wobei mir persönlich der Ausdruck Problembewusstein lieber ist, da das Wort Wissen, dessen Bedeutung so sehr nach abholbaren, handlich portionierten Weisheitspaketen klingt, mit meinem Philosophieverständnis wenig zu tun hat.
13.09.2016: Leben, Sterben und Tod

Leben, Sterben und Tod — das sind insgesamt die Ecksteine, die unserem Dasein einen nicht verhandelbaren Rahmen geben. Das ist den meisten Menschen einigermaßen einsichtig. Lediglich der Umgang mit diesem Faktum der eigenen Existenz ist subjektiv verschieden. Stellt sich also zunächst die Frage, welchen Beitrag die Philosophie in einer Angelegenheit zu Leisten imstande ist, die vermeintlich hochgradig den Einzelnen betrifft; in der es nicht so leicht vorstellbar ist, dass hier auch allgemeine Prinzipien von besonderer Relevanz sein könnten. Doch ohne Zweifel: Leben, Sterben und Tod waren immer schon Gegenstände philosophischer Reflexion.
In einem 2013 entstanden Text beleuchte ich anthropologische, ethische und metaphysische Dimensionen von Leben, Sterben und Tod. Den Text finden Sie in den Publikationen, alphabetische sortiert unter “L”.
02.09.2016: Kolumne "Philosophisch gedacht"

Der Fall des Homo sapiens sapiens
Der rasante Aufstieg des Homo sapiens sapiens, des modernen, über die Maßen verständigen, verstehenden und klugen Menschen, mag viele Gründe haben. Doch von überragender Bedeutung sind ohne Zweifel die Ausbildung und der Gebrauch einer immer differenzierteren Sprache. Sie dient nicht nur der Verständigung der Individuen untereinander, ist nicht nur die fundamentale Voraussetzung für alle, auf komplexe Kooperation fußenden großen gesellschaftlichen Funktionsbereiche wie Wirtschaft, Wissenschaft und Politik, sondern ist eine schlechthin unverzichtbare Grundlage des Denkens. Sprache ist nicht nur ein Mittel zum Ausdruck oder zur Mitteilung von Denkinhalten, sondern Denken und Sprechen bilden weithin eine Einheit. Das hat Leibniz lange vor Humboldt nachdrücklich betont. In §1 der Unvorgreiflichen Gedanken ist zu lesen: „Es ist bekannt, daß die Sprache ein Spiegel des Verstandes ist, und dass die Völker, wenn sie den Verstand hoch schwingen, auch zugleich die Sprache wohl ausüben“ (Unvorgreifliche Gedanken, 1697). „Mit ihr nämlich werden Verstand und Gelehrsamkeit, Wissenschaft und gemeine Wohlfahrt, ja Moralität und Freiheit befördert“ (Poser, Hans, Leibniz Philosophie, 2016, S. 132). Doch um die Sprache des »klugen Tiers«, ist es schlecht bestellt. Die neuen, revolutionären Kommunikationsmittel, die damit einhergehende, atemberaubende Geschwindigkeit der Datenübertragung, die Dynamisierung von Arbeitsprozessen und die Digitalisierung fast aller Lebensbereiche, fordern ihren Tribut. Um den sich auskristallisierenden Anforderungen gerecht zu werden, wird der Sprachgebrauch beschleunigt, die Sprache selbst dabei demontiert und bis zur Unkenntlichkeit verstümmelt. Kommuniziert wird in Wortfetzen, Abkürzungen und Emoticons; auf Rechtschreibung und Interpunktion wird verzichtet; die Regeln der Grammatik werden ohne Bedenken ignoriert; Kategorienfehler und fehlerhafte Begriffsanwendung stehen an der Tagesordnung. Untrügliche Indizien für die Ausbreitung dieses Analphabetismus des 21. Jahrhunderts sind Beiträge in diversen Blogs, Foren, sozialen Netzwerken und Videoportalen. Was man hier bisweilen zu lesen und zu hören bekommt, lässt einen am Intellekt von Homo sapiens sapiens, mithin an dessen Geisteskraft, zweifeln. Aber auch im täglichen E-Mail-Wahnsinn hat man den Anspruch auf wohlgeformte Sätze längst aufgegeben. Selbst an Hochschulen greift man immer häufiger zur ökonomisierten Verständigung in Halbsätzen. Doch dieser Art Verlust der Sprache hat — den Schluss von Leibniz umgekehrt — fatale Konsequenzen. Er führt nämlich zur Korrosion der Denkfähigkeit. Am Ende wird Homo sapiens sapiens nicht nur unfähig sein, semantisch folgerichtige und kohärente Denkgebäude aufzustellen, sondern ebenso unfähig selbst einfache Zusammenhänge zu erfassen, zu reflektieren und sich diesbezüglich systematisch zu äußern. Er wird daher auf primitive Formen der Verständigung zurückgreifen müssen und dies wird ihm zum Verhängnis werden. Was einst seinen Aufstieg markierte — die Ausbildung und der Gebrauch differenzierter Sprache — wird dereinst — wenn sie untergegangen ist — seinen Fall bedeuten. Da klingen die Worte Leibniz’ mahnend: Zur Erkenntnisbemühung des Einzelnen muss die Sprachpflege in der Gemeinschaft hinzutreten. Nur so ist eine Steigerung der Ausdrucksfähigkeit und damit zugleich der Erkenntnisfähigkeit möglich, und nur so lassen sich Verstand und Gelehrsamkeit, Wissenschaft und gemeine Wohlfahrt, ja Moralität und Freiheit befördern (Vgl. Poser, Hans, Leibniz Philosophie, 2016).
Autor: Bernd Waß
Bild: picture alliance/dpa/J. Kalaene
Diskussionsbeiträge bitte an: b.wass@academia philosophia.com
- Diskussionsbeitrag von Rudolf Friedl, Kunstschaffender
Sehr geehrter Herr Dr. Wass! Ihre Besorgnis, daß die Sprache verarmt, teile ich durchaus. Ein langes Leben macht mich aber optimistisch! Die krampfhafte Vermeidung und Eindeutschung aller nicht deutschen Begriffe im unsäglichen dritten Reich, haben wir überstanden. Der absolute sprachliche Tiefpunkt, war der Ersatz des Wortes “Motor” durch “Zerknalltreibling”. In den 60er Jahren als man mittels Teleprinter exchange – Telex, kommunizierte, gab es wegen der Abrechnung in Anschlägen, gängige, heute vergessene Wortungetüme, oder Wortstummel. Mir ist noch “dringdrahten” in Erinnerung. Damit meinte man, gib rasch Antwort! Ein gut formuliertes Schreiben, eine gewählte Ansprache, die den Empfänger mit einer bildhaften Sprache erreicht, wird weiterhin geschätzt, ja oft bewundert. Wir werden auch die Internetstümmelsprache überstehen.
24.08.2016: Kolumne "Philosophisch gedacht"

Moral ohne Gott?
In der Wochenzeitung DIE ZEIT findet sich in der aktuellen Ausgabe N◦35/2016 ein Artikel von Jürgen Krätzer, Literaturdidaktiker an der Universität Halle-Wittenberg, mit dem Titel Atheismus ist immer noch erlaubt! Es geht wieder einmal um den Alleinanspruch der Religionen auf das Hoheitsgebiet der Moral. Ohne Gott kein moralisches Handeln, so der Tenor. „Ein zentrales Argument der Religionsverteidiger lautet, dass ein Mensch, der sich keiner höheren Instanz verantwortlich fühle, für unmoralisches Handeln prädestiniert sei.“ Ich möchte den Argumenten Krätzers, gegen eine solche Auffassung, ein weiteres hinzufügen.
Eine Institution, deren Mitglieder deshalb moralisch gut sind, weil sie entweder die Rechtsprechung eines allmächtigen Gottes fürchten oder sich einen persönlichen Vorteil im Reich des Ewigen erhoffen, widerspricht sich in ihrem Anspruch auf Moralität selbst. Wer das moralisch Verbotene deshalb unterlässt, weil er Strafe vermeiden will und das moralisch Gebotene deshalb tut, um sich einen Vorteil zu verschaffen, handelt nicht im höchsten Grad moralisch, sondern geradezu unmoralisch. Eine Einsicht, die man seit Kant hätte gewinnen können. Nicht unsere Ängste und Hoffnungen geben unserem Handeln einen moralischen Wert, nicht seine Zwecke und ebenso wenig seine Konsequenzen, sondern ausschließlich die Maxime, nach der sie beschlossen werden. Was wäre das für eine eigenartige Moral, in der das Gute nicht ausschließlich des Guten wegen gewollt wird? „Es liegt also der moralische Wert der Handlung nicht in der Wirkung, die daraus erwartet wird, also auch nicht in irgendeinem Prinzip der Handlung, welches seinen Bewegungsgrund von dieser erwarteten Wirkung zu entlehnen bedarf. Denn alle diese Wirkungen konnten auch durch andere Ursachen zu Stande gebracht werden, und es brauchte also dazu nicht des Willens eines vernünftigen Wesens […]. Es kann daher nichts anderes als die Vorstellung des Gesetzes an sich selbst, die freilich nur im vernünftigen Wesen stattfindet, sofern sie, nicht aber die verhoffte Wirkung, der Bestimmungsgrund des Willens ist, das so vorzüglich Gute, welches wir sittlich nennen, ausmachen […]“ (Kant, Immanuel: Kritik der praktischen Vernunft, 1974, S. 27). Wovon hier die Rede ist, ist aber weder ein Gesetz Gottes noch ein Gesetz des Rechts, sondern eines, das alle Moral ins vernünftige Wesen selbst hinein verlegt. Und so heißt dann auch bei Kant: „Handle nur nach derjenigen Maxime, durch die zugleich wollen kannst, daß sie ein allgemeines Gesetz werde“ (a. a. o. S. 51). Es ist der berühmte kategorische Imperativ, der nicht nur das moralische Handeln ins rechte Licht rückt, sondern es darüber hinaus von aller metaphysischen Last befreit. Das hat einen großen Vorteil: Moral wird durch und durch zur Menschensache! Die Regeln, die wir uns geben, die allgemeinen Gesetze des Sollens, müssen wir selbst hervorbringen und wir müssen sie vor uns selbst verantworten. Wir können nichts delegieren. Das Wichtigste aber: Nur auf diese Weise können wir gut sein des Gutseins wegen. Denn erst, wenn es keine Instanz mehr gibt, deren Urteil auch nur den geringsten Einfluss auf unser Handeln auszuüben vermag, bietet sich uns prinzipiell die Chance, das Gute ausschließlich des Guten wegen zu wollen. Und ob wir sie ergreifen oder nicht, liegt wieder nur an uns. Die Absenz eines Gottes ist also nicht der Untergang der Moral, sondern geradezu ihre Voraussetzung.
Autor: Bernd Waß
Bild: Shutterstock Standardlizenz
Diskussionsbeiträge bitte an: b.wass@academia philosophia.com
- Diskussionsbeitrag von Dr. Jürgen Krätzer, Universität Halle
Sehr geehrter Herr Dr. Waß, besten Dank – und ja, natürlich Kant, aber auch alle Utopie / Dystopie-Vorlagen bis hin zu Eggers haben da viel zu bieten. Leider war die Platzvorgabe sehr beschränkt. Schön, dass nun diese Ergänzung im Netz existiert.
20.08.2016: Auf den Spuren Thomas Bernhards

Ein Philosoph war Thomas Bernhard keiner. Ein höchst streitbarer Geist aber ganz bestimmt. Fast in der Manier eines Emil Cioran verletzte und verstörte er alles, was vielen noch immer als hoch und heilig gilt. Ohne Zweifel ein radikaler seines Fachs und einer der ganz wenigen österreichischen Schriftsteller, der es zu Weltgeltung gebracht hat. Weil nun mein lieber Freund Josef Stockinger nicht nur ein überaus reiches Bernhardwissen aufzuweisen hat, sondern zum großen Glück, neben dem Jugendfreund Bernhards, dem »Hippinger Hans«, auch noch mit seinem Halbbruder Peter Fabian bekannt ist, machen wir uns auf die Reise, diesem umstrittenen Charakter nachzuspüren.
Unser Weg führt uns zunächst nach Henndorf. Inmitten des Orts, unterhalb der Kirche, findet sich das »Häusel an der Tagerlenden«. Es ist das Geburtshaus Johannes Freumbichlers, Bernhards Großvater, dem er zeit seines Lebens eng verbunden bleibt. „Ein paar Schritte mit ihm, und ich war gerettet“, schreibt er in Ein Kind. Das 300 Jahre alte Haus wurde 2012 renoviert und ist seither Literaturhaus.
Es geht weiter zum Hof des Hippingerbauern nach Seekirchen. Noch heute trifft man dort den Jugendfreund Bernhards an, den »Hippinger Hansi«. Hier verbringt Bernhard, wie er später sagen wird, die glücklichste Zeit seines Lebens: „Hier war mein Paradies.“
Ein größerer Schlag bringt uns auf die »Krucka«, eine kleine Alm am Grasberg bei Gmunden. 1971 hat sie Bernhard vom Fuhrunternehmer Josef Schmid erworben. „Der Realitätenvermittler und also Grundstücksgeschäftemacher“ Karl Hennetmair, den Bernhard in seinem Roman Ja als Moritz auftreten lässt, hat sie ihm vermittelt. In einem 1989 erschienen Zeit-Artikel von Helmut Schödel, der Hennetmair in Salzburg trifft, um mit ihm nach Reindlmühl zu fahren — dem Einstieg in die Krucka —, ist zu lesen: „Vier Hektar gehören zum Haus, nach oben hin ist der Hochwald die Grenze und hier neben der Laubhütte wollte er damals begraben werden. Er habe gesagt: Da grabt’s mich einmal ein wie einen Hund“.
Von der Krucka zum Vierkanthof in Obernathal bei Ohlsdorf ist es ein Katzensprung. Dort treffen wir den Halbbruder Bernhards Peter Fabian. Wir besichtigen den Hof, die Wirtschaftsgebäude und auch die privaten Räumlichkeiten Bernhards. Doch zutiefst beeindruckend ist das Gespräch mit Fabian. Hier ist man Bernhard auf eine Weise nahe, die fast gespenstisch wirkt. Als wäre einer, der schon längst nicht mehr da ist, für einen kurzen Moment zurückgekehrt. Der Geist, dem wir nachzuspüren trachteten, hat sich immer weiter verdichtet und an dieser Endstation unserer Reise realisiert er sich nun in den Geschichten eines Mannes, der einer der letzten, noch lebenden ist, die zum engsten Familienkreis Bernhards gehören.
17.08.2016: Kolumne "Philosophisch gedacht"

Konrad Paul Liessmann und die Eröffnung der Salzburger Festspiele
“Wir leben in bewegten Zeiten: Terroranschläge, Amokläufe, ein dubioser Militärputsch in der Türkei, Brexit und die tiefe Krise der Europäischen Union, soziale Spannungen und Ängste allerorten, Kriege und Bürgerkriege, unzählige Menschen auf der Flucht und eine Kommunikationstechnik, die uns all dies hautnah, im Live-Stream erleben lässt. Nahezu reflexartig stellt sich die Frage, ob es überhaupt noch möglich ist, sich in solchen Zeiten ruhigen Gewissens dem Schönen und der Kunst, der Feier des ästhetischen Augenblicks und dem Genuss eines rauschenden Festes hinzugeben. Müsste nicht die Kunst selbst angesichts dieses Weltzustandes wenn nicht verstummen, so doch ihre Stimme in einem politischen Sinne erheben, müsste sie nicht eingreifen, zumindest aufmerksam machen, über sich hinausweisen auf jene unerträglichen Zustände, müsste sie nicht die aufrüttelnde Aktion anstelle der Verehrung des Schönen setzen?“
Mit diesen Worten, oder besser gesagt, mit diesen Fragen, hebt die Rede Konrad Paul Liessmanns zur Eröffnung der Salzburger Festspiele an. Und die Antwort, die er gibt, ist, abgesehen von der Sprach-
gewandtheit und vom genuin philosophischen Interesse, insofern bemerkenswert, als er die Kunst als Gravitationspunkt der Freiheit schlechthin denkt. Dass das künstlerische Werk gelingen kann, setzt ein Leben in Freiheit voraus. So wird die Freiheit aber nicht nur zum Gütekriterium des Gelungenen, sondern auch zur Achillesferse moderner, säkularer Gesellschaften. Ist sie nicht in allerhöchster Gefahr? Nicht nur ob der unfassbaren Gräueltaten verblendeter Religionsfanatiker, der Schwachsinnigkeit politischer Ideologie, der Dummheit wegen, weil wir zwar vernunftbegabt aber nicht vernünftig sind, sondern auch ob unseres wohlständigen Lebensstils? Sind wir nicht Gefangene in einem engen Korsett von Verpflichtungen, deren Urheber wir selbst sind? Und die Künstlerinnen und Künstler? Sind sie frei? Wollen oder müssen sie nicht auch dem Markt genügen, der Galeristin, dem Käufer? Wer vermag es also wirklich in Freiheit zu leben? Wem gelingt sein Werk tatsächlich? Ohne Zweifel: Fragen der Freiheit sind Fragen von existenziellem Rang. Doch dem Philosophen kommen diese Fragen noch zu früh. Es fehlt ihm nämlich der Anfangspunkt des Fragens als Richtschnur aller Antwort, mithin die Frage nach dem Wesen des Gesuchten. Was ist eigentlich gemeint, wenn von Freiheit die Rede ist? Wovon genau reden wir, wenn wir uns auf sie beziehen? Freiheit, so könnte man Liessmanns Ausführungen deuten, ist eine Absage an die Welt. Ein ‘Ich möchte lieber nicht’, um es mit Bartleby zu sagen. Ganz im Sinne der Diktatur der Kunst, wie sie Jonathan Meese fordert: entideologisiert euch, entreligiöisiert euch, entpolitisiert euch, entkommentiert euch. Überwindung von allem überhaupt. Nicht um etwas Neues hinzustellen, sondern um frei zu sein. Und so steht am Anfang der Freiheit das große Nein. Nein danke. Ich möchte lieber nicht.
Autor: Bernd Waß
Bild: Salzburger Festspiele
Diskussionsbeiträge bitte an: b.wass@academia philosophia.com
05.08.2016: Der Philosoph geht auf Reisen

Ich kann nicht behaupten, dass ich gerne verreise. Reisen ist anstrengend und einen Landstrich gesehen zu haben oder nicht, macht keinen relevanten Unterschied. Nichtsdestoweniger wird mir die bevorstehende Italienreise gut tun, wie ich glaube. Ich liebe nämlich den Sommer, warte aber vergebens, denn in Salzburg mag er nicht und nicht einziehen. Im Reisegepäck ein Hut, Zigarren und die schon erwähnte Arbeit über Gottfried Wilhelm Leibniz.
03.08.2016: Stilleben eines Philosophen

Abendlektüre. Eine Abhandlung über Gottfried Wilhelm Leibniz von Hans Poser, gegenwärtig einer der bedeutendsten Leibniz-Forscher. “In vier Jahrzehnten seiner Forschungs- und Lehrtätigkeit hat sich Hans Poser mit beinahe allen Aspekten des Leibniz’schen Denkens befasst und legt mit diesem Band eine systematisch angeordnete Zusammenführung seiner Überlegungen vor, die um das spannungsvolle Verhältnis von Metaphysik und Wissenschaft und deren Voraussetzungen kreisen.” Erschienen ist dieses Werk im Felix Meiner Verlag. Zum Lesegenuss wird eine Zigarre serviert, und zwar eine Joya de Nicaragua aus der Serie Celebracion.
